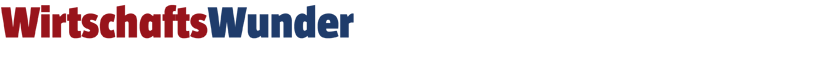Paul de Grauwe – Warum ein großer Rettungsschirm sinnvoll ist
Deutsche Ökonomen haben vor einer Ausweitung der EU-Hilfen für strauchelnde Staaten gewarnt. Sie offenbaren damit, dass sie nicht verstanden haben, wie die globalen Finanzmärkte oder die Währungsunion funktionieren.
Vor Kurzem warnten 189 deutsche Volkswirte als Plenum der Ökonomen davor, den Rettungsschirm für Euro-Länder auszudehnen und ihn ab 2013 zu einer ständigen Einrichtung zu machen. Die Art und Weise, wie die Volkswirte argumentieren, macht ihre Erklärung zu etwas Außergewöhnlichem: Die Argumente haben nichts damit zu tun, wie Finanzmärkte tatsächlich funktionieren.
Ihr erstes Argument fußt auf der Vorstellung, dass Finanzmärkte Liquiditätsprobleme von Schuldenproblemen trennen können. Auf den ersten Blick ein trügerisch einfaches Argument: Länder, die solvent sind, aber kein flüssiges Kapital haben, benötigen den Rettungsschirm nicht, weil sie am Markt Geld einsammeln werden. Insolvente Staaten dagegen werden keine Mittel am Markt bekommen, und sie verdienen es nicht, vom Rettungsschirm mit Liquidität versorgt zu werden. Im ersten Fall wäre der Schirm demnach überflüssig, im zweiten Fall gefährlich.
Dieses Argument ist insofern ungewöhnlich, weil dahinter der naive Glaube steckt, dass Finanzmärkte effizient sind. Die Realität sieht ganz anders aus. Vor Ausbruch der Finanzkrise waren die Märkte euphorisiert und unterschätzten die Risiken einer Solvenzkrise wie auch einer Liquiditätskrise drastisch. Sie ließen es zu, dass Banken und Haushalte massiv Schulden anhäuften. Paradoxerweise reduzierten zur selben Zeit die Regierungen der Euro-Länder ihr Verschuldungsniveau (gemessen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt). Als die Blase platzte, mussten die Regierungen, um ein Implodieren des Bankenwesens zu vermeiden, in großem Maße Privatschulden übernehmen. Seitdem erlebten die Finanzmärkte Panikanfälle und belegen Solvenz- und Liquiditätsrisiken mit hohen Aufschlägen. Wenn sie in Vorkrisenzeiten mit ihrer Euphorie so systematisch danebenlagen, warum sollten sie jetzt richtigliegen?
Furcht neigt dazu, sich selbst zu bewahrheiten. Befürchten die Märkte heute beispielsweise einen Zahlungsausfall Portugals, erhöhen sie die Zinsen auf portugiesische Staatsanleihen. Dadurch steigt das Ausfallrisiko, was die ursprüngliche Angst bestätigt. Die Konsequenz ist, dass Portugals Regierung nun 7,7 Prozent Zinsen bezahlen muss. Bei diesem Zinssatz ist der Staat tatsächlich zahlungsunfähig – wie wohl alle Euro-Staaten.
In der Tat könnten einige Staaten – insbesondere Griechenland – schon heute zahlungsunfähig sein. Der Markt scheint jedoch zu der Einschätzung gekommen zu sein, dass Länder wie Irland und Portugal ebenfalls zahlungsunfähig sind. Aber sind die hohen Zinsen, die jetzt für Staatsanleihen fällig werden, das Resultat rationalen Abwägens durch die Investoren oder das Resultat ihrer Ängste?
Ein zweites trügerisches Argument, das die deutschen Volkswirte heranziehen, basiert auf dem „Moral Hazard“. Insolventen Staaten Liquidität bereitzustellen würde in den Worten der Unterzeichner „hoch verschuldeten Ländern massive Anreize bieten, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen und eine Verschuldungspolitik zulasten der EU-Partner fortzusetzen“. Das Argument ist beliebt, weil es einen starken emotionalen Inhalt birgt: Staaten mit hohen Schulden und Defiziten haben verantwortungslose Regierungen. Sie sollten bestraft werden, damit sie ihre Fehler nicht wiederholen.
Aber genau das tut der EU-Rettungsschirm, und der Europäische Stabilisierungsmechanismus wird es auch tun. Nicht nur, dass der Rettungsschirm die Kredite an die Staaten mit hohen Zinsen belegt – im Fall Irlands liegt dieser Zinssatz bei sechs Prozent. An die Kredite ist auch die Bedingung geknüpft, ein umfassendes Sparprogramm umzusetzen. In Irland werden unter anderem die Löhne im öffentlichen Dienst um 15 Prozent gekürzt, die Steuern erhöht und viele Sozialleistungen zusammengestrichen. Tatsache ist, dass die irische Regierung infolgedessen die Wahl verloren hat und (teilweise) zurücktreten musste. Zu argumentieren, die Kreditbedingungen seien „günstig“ und böten Regierungen „massive Anreize, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen“, ist daher verblüffend.
Schließlich basiert die Erklärung der Ökonomen auf einem mangelnden Verständnis der Natur einer Währungsunion. Seit dem Beginn der Euro-Zone hat sich die finanzielle Integration dramatisch verstärkt. Eine Folge davon ist, dass die Staatsanleihen vieler Euro-Länder inzwischen Besitzer außerhalb des jeweiligen Emissionslands gefunden haben. Zumeist sind die Besitzer Finanzinstitute. Diese finanzielle Integration führt zu einer engen Verbindung zwischen dem Zustand der Regierungen und dem Bankensektor in der Euro-Zone. Und sie führt zu einem enormen Dominoeffekt. Wenn Anleger sehen, dass der Wert griechischer Staatsanleihen sinkt, verkaufen sie aus Angst Staatsanleihen Irlands, Portugals, Spaniens und Belgiens. Doch dadurch entsteht das Risiko, dass Banken in „AAA“-Ländern in Mitleidenschaft gezogen werden. Da können die Regierungen dieser Länder nicht gleichgültig zusehen. Ob es ihnen gefällt oder nicht, sie sind gezwungen, Liquidität bereitzustellen, damit ihr eigener Bankensektor nicht durch einen Dominoeffekt instabil wird.
Eine Währungsunion kann nur dann funktionieren, wenn ein verlässlicher Mechanismus für Finanzhilfe in Krisenzeiten besteht. Natürlich sollte dieser Mechanismus so eingerichtet sein, dass er keine Anreize schafft, „Fehler der Vergangenheit zu wiederholen“. Der jetzige europäische Rettungsschirm bietet keine derartigen Anreize. Sein bestrafender Charakter veranlasst jede Regierung, genau zu überlegen, ob sie bei ihm anklopft.
Paul de Grauwe ist Professor der belgischen Universität Leuven und Berater der EU-Kommission.