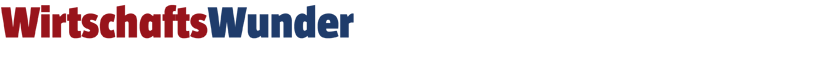L. Randall Wray: Modern Money Theory
Ökonomische Revolution oder Geldflutung? Eine Einführung
Haushalte oder Unternehmen.
• Der Staat erschafft Geld aus dem Nichts. Mit Steuern schafft er Nachfrage nach diesem Geld.
• Das Geld war immer schon ein Schuldschein des Staates.
• Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Souveränität des Staates, Geld zu erschaffen, und Inflation.
• Das Grundprinzip jeder Rechnungslegung lautet, dass jedem finanziellen Vermögenswert eine gleichwertige
Verbindlichkeit gegenübersteht.
• Die Krise in der Eurozone ist die Folge eines Konstruktionsfehlers.
• Der Staat sollte Vermögen nicht umverteilen, sondern mit seiner Geldschöpfungskraft die Arbeitslosigkeit
beseitigen.
Rezension
Dass Geld von Zentralbanken und Geschäftsbanken per Knopfdruck geschaffen wird, ist kein Geheimnis.
Dennoch wird der politische Diskurs von der Vorstellung beherrscht, der Staat müsse wie die sprichwörtliche schwäbische Hausfrau wirtschaften und könne nur ausgeben, was er vorher eingenommen hat. Die Modern Money Theory rührt an diesem Tabu, indem sie zentrale Lehrsätze der Ökonomie infrage stellt. L. Randall Wrays Einführung in die Theorie ist keine leichte Kost, auch weil sie Denkgewohnheiten unterläuft. Doch wer sich darauf einlässt, gewinnt eine radikal neue Perspektive auf unser Geldsystem.
Zusammenfassung
Die Führung des Staatshaushalts folgt fundamental anderen Prinzipien als die
Führung privatwirtschaftlicher Haushalte oder Unternehmen.
Die Modern Money Theory, abgekürzt MMT, ist ein relativ junger Ansatz in der ökonomischen Theorie. Ihre Ideen fußen aber auf Erkenntnissen von Ikonen der Wirtschaftswissenschaften wie John Maynard Keynes oder Hyman Minsky. Die MMT kritisiert die Realitätsferne des wissenschaftlichen Mainstreams in Bezug auf die Finanzmärkte. Sie stellt dagegen den enormen Einfluss der Finanzmärkte auf das wirtschaftliche Geschehen in den Mittelpunkt. In der Forschungslandschaft gehört die MMT zu den alternativen ökonomischen Schulen. Von den makroökonomischen Lehren, die an den Universitäten dominieren, setzt sie sich stark ab.
Die grundlegenden Einsichten der MMT widersprechen vielen gängigen Annahmen über das Geldsystem.
Denn sie zeigen, dass die staatlichen Finanzen keineswegs mit den privatwirtschaftlichen Haushalten oder
den Unternehmen vergleichbar sind. Letztere können nur ausgeben, was sie vorher eingenommen haben.
Ein souveräner Staat aber, der seine eigene Währung herausgibt, kann so viel Geld drucken, wie er will.
Zahlungsunfähigkeit ist für einen solchen souveränen Staat, im Gegensatz zu einer Privatperson oder einem Unternehmen, keine reale Bedrohung.
Der Staat erschafft Geld aus dem Nichts. Mit Steuern schafft er Nachfrage nach
diesem Geld.
Der Staat muss nicht erst Steuern einnehmen, um das Geld dann ausgeben zu können. Vielmehr ist es
umgekehrt: Der Staat gibt seine Währung heraus, damit die Bürger Steuern zahlen können. Die Regierung
braucht weder Steuereinnahmen, noch muss sie sich Geld leihen, also Staatsanleihen emittieren, um ihre
Ausgaben zu finanzieren.
„Steuern schaffen eine Nachfrage nach der eigenen Währung des Staates, sodass der
Staat die Währung ausgeben (oder verleihen) kann.“
Der wirkliche Zweck der Steuern, die der Staat erhebt, ist nicht die Bereitstellung von Mitteln für die Staatsausgaben, sondern die Schaffung einer Nachfrage für die eigene Währung. Diese ist die Grundlage für die Akzeptanz der Währung als Zahlungsmittel. Die Regierungen schaffen folglich Geld aus dem Nichts. Das ist kein Vorschlag, wie es sein könnte oder sollte, sondern es ist die Beschreibung der Arbeitsweise der Zentralbanken souveräner Staaten.
Das Geld war immer schon ein Schuldschein des Staates.
Eine weit verbreitete Geschichte des Geldes geht ungefähr so: In grauer Vorzeit kam jemand auf die großartige Idee, den umständlichen Tauschhandel durch die Einführung eines allgemein akzeptierten Tauschmittels zu revolutionieren. Dafür wurden zunächst Muscheln oder Ähnliches benutzt, aber bald setzten sich aus Edelmetallen geprägte Münzen durch. Später führten die Regierungen dann Papiergeld oder Münzen aus unedlen Metallen ein. Diese waren selbst nicht mehr aus Edelmetallen, verbrieften aber den Anspruch, dass sie in Gold eingelöst werden konnten. Am Ende dieser Geschichte stehen die modernen, heute üblichen Währungen, das sogenannte Fiatgeld. Im Gegensatz zu den alten, durch Edelmetalle gedeckten Währungen, ist Fiatgeld durch keinen „echten“ Wert mehr gedeckt. Der Goldstandard, also die Deckung des Werts des Geldes durch die Goldreserven der Notenbanken, galt bis in die 1970er-Jahre. Bis dahin hatte das Abkommen von Bretton Woods die nationalen Währungen über den Dollar an den Wert des Goldes gebunden. Dies beinhaltete das Versprechen, eine festgelegte Summe in Dollar in eine festgelegte Menge Gold umtauschen zu können. Seit dem Zusammenbruch dieses Systems Anfang der 1970er-Jahre ist der Wert des Geldes nur noch durch das Versprechen der Notenbank gesichert, die Währung stabil zu halten.
„Geld ist ein ‚Tokenʻ, wie der Garderobenzettel, den man am Ende der Opernvorstellung
gegen seinen Mantel eintauschen kann.“
Schaut man sich allerdings diese Geschichte genauer an, dann erweist sich, dass auch das alte Warengeld
immer schon ein Schuldschein des Staates war. Der war nur zufällig auf eine Goldmünze geprägt. Die
Münzen ersetzten und ergänzten die vorher geläufigen, auf Ton geritzten Aufzeichnungen, die sehr ähnlich unseren modernen, elektronisch gespeicherten Datensätzen die ersten Geldsysteme darstellten. In diesen Aufzeichnungen wurde festgehalten, wer wem wie viel schuldete oder bereits gezahlt hatte. Die Münzen waren nichts anderes als Zähleinheiten zur Berechnung von Schulden.
„Edelmetallmünzen waren immer Aufzeichnungen von Schuldscheinen, aber sie waren
unvollkommen. Und auf jeden Fall haben sie Historiker und Wirtschaftswissenschaftler
in die Irre geführt!“
Es ist kein Zufall, dass die frühen Geldeinheiten allesamt Namen hatten, die von den Maßen des Hauptnahrungsmittels Getreide abgeleitet waren. Das Geld war also eine Rechnungseinheit und eher die Aufzeichnung einer Information als ein materieller Wert. Bereits bei den Römern wurde der Wert der Münzen nicht durch einen intrinsischen Wert bestimmt, sondern durch einen von den Behörden festgesetzten Nennwert
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Souveränität des Staates, Geld zu
erschaffen, und Inflation.
In allen modernen Währungssystemen wird Fiatgeld verwendet. Es ist ein Wirtschaftsobjekt ohne inneren
Wert. Viele Kritiker des Fiatgeldes trauern den alten Zeiten des Goldstandards hinterher. Das Fiatgeld sei, so ihr wichtigster Einwand, anfällig für Hyperinflation. Denn die Bindung des Geldes an einen nicht beliebig reproduzierbaren Wert verhindere die Entwertung des Geldes. Als Beispiele werden dabei meist die großen Währungskrisen in der Weimarer Republik oder in jüngerer Zeit in Simbabwe angeführt. Es wird argumentiert, dass die katastrophale Hyperinflation, die das Vermögen vieler Menschen vernichtete, dadurch zustande gekommen sei, dass der Staat schrankenlos immer mehr Geld gedruckt habe.
Wenn es allerdings so wäre, dass die Fähigkeit des Staates zur Geldschöpfung zu hohen Inflationsraten
oder gar Hyperinflation führt, müssten wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich in allen Industriestaaten
ständig enorme Währungskrisen gehabt haben. Tatsächlich aber ist das ein sehr seltenes Ereignis. Rein
empirisch lässt sich kein Zusammenhang finden zwischen Inflation und der Souveränität der Staaten, Geld
in ihrer eigenen Währung in beliebiger Menge zu schaffen. Vielmehr hat in den letzten hundert Jahren
kein Industrieland mit einer Fiatwährung eine Hyperinflation erlebt. Von solchen Krisen sind vielmehr
Staaten betroffen, die Geld in ihrer Währung nicht souverän schaffen können, die von sozialen und politischen Umbrüchen betroffen sind, deren Produktionskapazitäten zusammenbrechen oder die von großen Auslandsschulden belastet sind.
„Wir hatten viel zu viel private ‚Geldschöpfungʻ, die die ausufernden Finanzmärkte anheizte, und viel zu wenig staatliche ‚Geldschöpfungʻ, die dem öffentlichen Zweck diente.“
Auch die Geschäftsbanken schaffen Geld aus dem Nichts. Es ist nicht so, wie es die klassische Ökonomie
behauptet, dass sie die Ersparnisse der einen als Kredite an die anderen ausreichen. Die Banken brauchen
keine Einlagen von ihren Kunden im Tresor oder auf den Konten, um Kredite zu vergeben. Sie vergeben
einen Kredit einfach, indem sie eine Zahl in den Computer eingeben, also indem sie Geld schaffen. Sie
handeln wie der Staat, der Geld als Kredite ausgibt, die durch die Steuern wieder zurückgezahlt werden.
Dennoch sind Zentralbanken ebenso wie Geschäftsbanken in ihrer Geldschöpfung beschränkt. In den USA
etwa unterliegt die Fed einer von Kongress und Präsident definierten Schuldengrenze. Auch die Geschäftsbanken unterliegen Beschränkungen. Sie können nur Kredite an solche Schuldner vergeben, die kreditwürdig sind, die also mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Schulden zurückzahlen werden. Werden die mit der Kreditvergabe verbundenen Risiken nicht richtig bewertet, hat das katastrophale Folgen, nicht nur für die Bank. In den letzten Jahrzehnten wurden die Beschränkungen der Banken gelockert, was einer der Gründe für die Finanzkrise war. Das Problem war aber nicht die Fähigkeit der Banken, einfach Geld aus dem Nichts zu schöpfen, sondern vielmehr die Menge des Geldes, das sie schufen, und mehr noch die vielfach wirtschaftlich nutzlosen Zwecke, für die es geschaffen wurde.
Das Grundprinzip jeder Rechnungslegung lautet, dass jedem finanziellen
Vermögenswert eine gleichwertige Verbindlichkeit gegenübersteht.
Es ist unmöglich, die Debatte um Staatsverschuldung zu verstehen, ohne die Grundlagen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu begreifen. Dafür braucht es keine anspruchsvollen Mathematikkenntnisse. Es geht lediglich um logisches Denken. Das Grundprinzip jeder Rechnungslegung lautet, dass jedem finanziellen Vermögenswert eine gleichwertige Verbindlichkeit gegenübersteht. Anders gesagt, die Vermögen der einen sind die Schulden der anderen.
Man unterscheidet in der Volkswirtschaft verschiedene Sektoren. Die grundlegendste Unterscheidung ist die zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor. Der öffentliche Sektor umfasst alle staatlichen Einheiten sowie staatlich kontrollierte Unternehmen und Einrichtungen. Der private Sektor umfasst die privaten Haushalte und die privaten Unternehmen. Nach dem Grundprinzip der Rechnungslegung müssen die aufsummierten Defizite oder Überschüsse der beiden Sektoren zusammen null ergeben. Es können also nicht beide Sektoren gleichzeitig Überschüsse oder Defizite erwirtschaften. Das Nettofinanzvermögen des privaten Sektors muss zwangsläufig negativ sein, wenn der Staat seinen Haushalt im Plus abschließt. Umgekehrt steht einem positiven Vermögen des privaten Sektors ein Defizit des Staates gegenüber.
„Wenn der Staat kontinuierlich Haushaltsüberschüsse erzielt, muss das Nettofinanzvermögen des privaten Sektors negativ sein. Mit anderen Worten: Der private Sektor wird sich beim öffentlichen Sektor verschulden.“
Die nationalen Volkswirtschaften sind aber keine abgeschlossenen Gebilde, sondern sie interagieren mit
dem Rest der Welt. Es ist deshalb sinnvoll, einen dritten Sektor hinzuzufügen: Neben dem inländischen
öffentlichen und privaten Sektor ist dies das Ausland. Dieser Sektor umfasst alle ausländischen staatlichen
Einheiten sowie die ausländischen Unternehmen und Privathaushalte. Auch die aufsummierten Defizite
oder Überschüsse der drei Sektoren müssen zusammen null ergeben. Die Gleichung lautet also: privater
Saldo des Inlands + staatlicher Saldo des Inlands + ausländischer Saldo = null. Nun ist es zwar möglich,
dass der private Sektor im Inland Nettofinanzvermögen anhäuft, ohne dass der Staat Defizite erwirtschaftet. Dann aber muss das Defizit im Ausland anfallen, das heißt, das Ausland hat Schulden gegenüber den inländischen Sektoren. Ein Überschuss in einem der drei Sektoren geht also zwangsläufig mit einem Defizit in mindestens einem der anderen beiden Sektoren einher.
Die Krise in der Eurozone ist die Folge eines Konstruktionsfehlers.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Diskussion um die Probleme der Eurozone in einem anderen Licht.
Die Geschichte von den vermeintlich sparsamen und fleißigen Nordländern, die die angeblich verschwenderischen und faulen Südländer mit vielen Milliarden Euro aus der von ihnen verursachten Krise retten müssen, entspricht nicht der Realität. Denn auch hier gilt das Grundprinzip der Rechnungslegung. Die Außenhandelsüberschüsse des Exportweltmeisters Deutschland müssen woanders als Defizite bilanziert werden. Deutschland war der größte Profiteur der Euro-Einführung: Es konnte das eigene Haushaltsdefizit niedrig und zugleich die privaten Vermögen auf hohem Niveau halten, weil die Nachbarländer entsprechend Schulden anhäuften und mit ihren Importen aus Deutschland das Wachstum der deutschen Wirtschaft sicherstellten.
Die Krise in der Eurozone ist die Folge eines grundlegenden Konstruktionsfehlers. Die Länder haben mit der Einführung des Euro ihre Souveränität aufgegeben. Seine Einführung kommt aus der Perspektive der Staaten fast der Annahme einer Fremdwährung gleich. Die Aufgabe der eigenen Währung führte zu einer massiven Einschränkung der finanzpolitischen Handlungsfähigkeit. Die Haushaltsdefizite und Schuldenquoten der südeuropäischen Länder waren vor der Krise im internationalen Vergleich nicht exorbitant. Vielmehr waren Verschuldung und Defizit etwa in Japan bedeutend höher und in den USA vergleichbar. Die Länder gerieten in die Schuldenkrise, weil sie ihre Verbindlichkeiten nicht mehr mit einem Tastendruck bedienen konnten.
Der Staat sollte Vermögen nicht umverteilen, sondern mit seiner Geldschöpfungskraft die Arbeitslosigkeit beseitigen.
Um die Ungleichheit, die auch in vielen Industrieländern dramatisch zugenommen hat, zu reduzieren, wird
vielfach mehr Umverteilung gefordert. Gutverdienende und Vermögende sollen höher besteuert werden,
um die damit eingenommenen Mittel an Menschen mit niedrigen Einkommen umzuverteilen. Man stellt
sich den Staat als eine Art Robin Hood vor, der den Reichen wegnimmt, um den Armen zu geben. Das
ist zwar eine romantische Vorstellung, sie geht aber an der Realität vorbei. Das eine hat mit dem anderen
nämlich gar nichts zu tun. Zwar mag die Abschöpfung hoher Einkommen oder Vermögen aus vielen
Gründen wünschenswert erscheinen, aber der Staat ist nicht auf die Besteuerung angewiesen, um arme
Menschen zu unterstützen. Er könnte für diesen Zweck so viel Geld schaffen, wie er will.
„Nehmt von den Reichen und gebt den Armen. Wir lieben diese Geschichte. Aber sie beruht auf dem Missverständnis, dass wir die von den Reichen bezahlten Steuern brauchen, um den Armen zu helfen.“
Viel effizienter wäre eine Vorverteilung. Der Staat sollte Arbeitsplätze mit auskömmlichen Löhnen für
Menschen mit geringem Einkommen und vor allem für die Arbeitslosen schaffen. Denn Arbeitslosigkeit
verursacht nicht nur für die betroffenen Menschen großes Leid, sondern auch enorme soziale und wirtschaftliche Kosten. Viele Regierungen argumentieren, dass das nicht finanzierbar ist. Wenn nun aber der Staat alles bezahlen kann, was in seiner eigenen Währung zu kaufen ist, ist dieser Einwand nicht mehr stichhaltig. Es ist eine politische Entscheidung, wofür Mittel aufgewendet werden. Es geht nicht darum, was eine Regierung finanzieren kann, sondern vielmehr, was sie tun sollte.
„Es mag Gründe geben, warum wir Millionen von Arbeitnehmern arbeitslos lassen, mit unsicheren Brücken und Autobahnen leben oder auf der Erde bleiben wollen, aber an mangelnder Finanzierung kann es nicht liegen.“
Eigentlich ist das Geld eine großartige Erfindung. Es erlaubt die Verfolgung individueller Zwecke, befördert unternehmerische Initiative und Innovation und organisiert die komplexen Prozesse der Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen. Und es stellt dem Staat die Ressourcen zur Verfügung, um eine gerechte, lebenswerte Gesellschaft zu formen. Es geht darum, es zu nutzen, um füreinander zu sorgen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen
Über den Autor
L. Randall Wray lehrt Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri-Kansas City und am Levy
Economics Institute des Bard College, New York. Er war Schüler von Hyman P. Minsky an der Washington
University in St. Louis. Seine Schwerpunkte sind Geldtheorie und -politik, Makroökonomie und Beschäftigungspolitik.