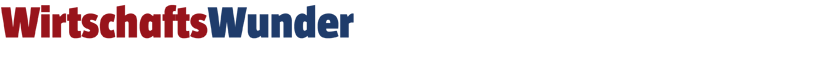Archiv
Post aus Washington: Spiel mit dem Protektionismus
Knapp zwei Jahre vor den nächsten Wahlen ist es in Amerika erschreckend gängig, die Globalisierung für alle möglichen eigenen Probleme verantwortlich zu machen. Eine Auswahl.
Glaubt man gängigen Clichés, so ist der Amerikaner grundsätzlich markt- und globalisierungsfreundlich, während sich der Deutsche noch nie so recht mit unregulierten Märkten anfreunden konnte und sich deshalb verzweifelt an der sozialen Marktwirtschaft festklammert. Fast schon überraschend ist vor diesem Hintergrund, welch protektionistischen Töne bereits jetzt, zwei Jahre vor der nächsten Präsidentschaftswahl, hier in Washington angeschlagen werden.
Immer wieder spricht etwa die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton von der amerikanischen Mittelschicht, die durch Jobverlagerungen unter Druck gerät. Auf einer Veranstaltung in Washington erzählte sie minutenlang von einem Ingenieur aus einem der ländlichen US-Staaten, der derzeit einen Ingenieur aus Indien anlernen muss, der demnächst seinen Arbeitsplatz einnehmen wird. Ihr Fazit: Diese Menschen hätten alles richtig gemacht, sich um eine gute Ausbildung bemüht, hart gearbeitet und würden jetzt durch die Globalisierung ihren Arbeitsplatz verlieren. Dies dürfe in Amerika nicht so sein. Vor allem aber dürfe nicht sein, dass Amerikas Jobs verlagert würden, weil andere Länder unfaire Billigkonkurrenz machten.
Auch ihr Parteikollege Jim Webb, der für die Demokraten die Erwiderung auf die State of the Union Address von Präsident George W. Bush hielt, blies in das gleiche Horn. „Unsere Industriebasis wird demontiert und nach Übersee verschickt. Gute amerikanische Jobs werden mitverlagert. [… Die Betroffenen] erwarten – korrekterweise – dass im Zeitalter der Globalisierung ihre eigene Regierung sich darum kümmert, dass in den internationalen Märkten ihre Angelegenheiten fair behandelt werden.” Sprich: Wenn die US-Unternehmen nicht alleine die Jobs im Land halten können, müsse eben die Regierung mit Druck auf andere Länder oder Konzerne nachhelfen.
Die Debatte in Deutschland und den USA über die Folgen der Globalisierung läuft damit in zwei völlig entgegen gesetzte Richtungen: Während auf dem Höhepunkt der deutschen Jobverlagerungsdebatte 2004 sich alles darum drehte, was man zu Hause alles anders machen könne, um mit der Globalisierung klarzukommen, wendet man sich in den USA vor allem der Frage zu, was am Welthandelssystem anders werden muss, damit Amerika mit der Globalisierung klarkommt. Während in Deutschland auf die Niedriglohnkonkurrenz in Osteuropa und Asien mit Arbeitszeitverlängerungen, Hartz-Reformen und der Forderung nach Senkung der Lohnnebenkosten reagiert wurde, rufen die Amerikaner nach einer Aufwertung der chinesischen Landeswährung Renminbi oder Mindeststandards bei den Arbeitsbedingungen in den Fabriken in Vietnam. Das linke, gewerkschaftsnahe Economic Policy Institute hat jüngst sogar ein Stopp über mehrere Jahre über jegliche weiteren internationalen Handelsverträge gefordert. In Deutschland sind solche Forderungen selbst von der Gewerkschaftsseite undenkbar.
Wenn in Deutschland die verfügbaren Einkommen nicht steigen, ist die eigene Wirtschaftspolitik und das eigene Sozialsystem Schuld. Wenn in den USA die Arbeitnehmereinkommen stagnieren, wird gerne die Verantwortung inzwischen in der Globalisierung gesucht.
Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass die Amerikaner mehr Macht haben, die Globalisierung zu beeinflussen. Ob diese Vermutung stimmt, ist allerdings fraglich. Deutschland hätte sicher auch die Aufnahme der Osteuropäer in die EU verzögern können. Insgesamt ist auch die EU nicht unbedingt in Fragen des globalen Handels weniger einflussreich als die USA. Vielleicht sind die Deutschen doch einfach nicht so marktfeindlich, wie gerne immer wieder verbreitet wird.
Von Sebastian Dullien
Post aus Washington – Politische Budget-Ökonomie
Während der Haushaltsplan von Präsident George W. Bush in Deutschland nur begrenzt auf Aufmerksamkeit gestoßen ist, waren die Zeitungen in den USA voll mit Berichten und Analysen. Mit gutem Grund.
Auch wenn die Republikaner keine Mehrheit mehr im Kongress (der über Ausgaben und Steuern entscheidet) haben und damit der Haushaltsvorschlag des Präsidenten weniger Bedeutung hat als etwa der Budgetentwurf der deutschen Bundesregierung, spielt in der politischen Debatte die Vorlage aus dem Weißen Haus immer noch eine zentrale Rolle.
Besonders auffällig waren diesmal die Vorschläge Bushs, Einschnitte bei den Sozialleistungen zu machen. So sollen künftig reichere Alte, die eigentlich unter die staatliche Gesundheitversorgung „Medicare“ fallen, einen höheren Anteil der Kosten für ihre medizinischen Behandlungen selbst tragen. Bei der staatlichen Rentenversicherung würde Bush gerne eine Regelung einführen, nach der Besserverdienende einen kleineren Anteil ihres früheren Einkommens als Rente erhalten als Geringverdiener.
Obwohl man auf den ersten Blick glauben könnte, die Demokraten dürften solchen Plänen gar nicht unbedingt abgeneigt sein, sind die Pläne für die Linke in Amerika ein rotes Tuch. Tatsächlich nämlich geht es um viel mehr als die bloße Begrenzung der Ausgaben. Es geht vielmehr um die politische Ökonomie der Zustimmung zu Sozialtransfers. Als der demokratische Präsident Lyndon B. Johnson den Plan einer „Great Society“ ausrief, war einer der Ideen, Sozialleistungen auf einen derart großen Teil der Bevölkerung auszudehnen, dass jeder potenziell Profiteur sein könnte. Das Kalkül der Linken war damals, dass unter dieser Voraussetzung die Zustimmung zu Sozialprogrammen viel höher ausfallen werde.
Und tatsächlich sind heute zum großen Missfallen einiger Republikaner sowohl das staatliche Rentensystem als auch die staatliche Gesundheitssicherung für die Alten unter den Amerikanern höchst beliebt. Republikanische Think-Tanks empfehlen deshalb derzeit die gegenläufige politische Ökonomie von Johnsons Strategie: Man solle doch bitte versuchen, die Sozialsysteme für möglichst viele aus der Mittelschicht unattraktiv zu machen. Ein regressives Rentensystem wäre ein erster Schritt dazu: Es würde über die Sozialabgaben (die US-Rente wird über eine proportionale Abgabe auf den Lohn finanziert) eine zusätzliche Umverteilung einführen. Die Rendite der Mittelklasse würde sinken – und damit ihre Zufriedenheit mit dem System abnehmen.
Ob Bushs Rechnung allerdings aufgeht, ist fraglich: Im Kongress werden die Demokraten seinen Plänen kaum zustimmen und selbst unter einer republikanischen Mehrheit hat Bush keine Rentenreform durchsetzen können.
Von Sebastian Dullien
Post aus Washington: Überschätzte IWF-Prognosen
Blickt man aus Deutschland über den Atlantik zum Internationalen Währungsfonds (IWF), dann meist mit bewundernder Ehrfurcht. Dabei sind die Wachstumsprognosen der Fondsökonomen überhaupt nicht besser als jene der deutschen Konjunkturforscher – und den Washingtoner Experten ist das sogar bewusst.
Vor allem die halbjährlichen Prognosen des Währungsfonds haben es dem politischen Berlin dabei angetan: Sobald eine der großen Zeitungen in Deutschland die neuesten Projektionen der Washingtoner Ökonomen oder auch nur einen Entwurf davon in die Hände bekommt, werden diese breit, gerne auch auf der Titelseite, ausgeschlachtet. Auch die Politiker benutzen die Vorhersagen des Fonds mit Begeisterung: Fallen die Vorhersagen gut aus, führt der Finanzminister den IWF als Bestätigung seiner Politik an; fallen die Zahlen schlecht aus, verweist die Opposition auf diese Zahlen – zuletzt etwa FDP-Politiker, die noch weit ins Boomjahr 2006 hinein die pessimistischen IWF-Prognosen als Beleg für das Scheitern der Politik der großen Koalition anführten.
Die Aufmerksamkeit, die dem Fonds bei diesen Vorhersagen zuteil wird, steht dabei in keinerlei Verhältnis zur Treffsicherheit. Im Herbst 2005 noch sagten die Fondsexperten für Deutschland 2006 ein Wachstum von lediglich 1,2 Prozent vorher. Nach aktueller Messung waren es tatsächlich 2,5 Prozent, wobei möglicherweise die Zahlen sogar noch einmal nach oben revidiert werden. Auch als viele Bankvolkswirte ihre Prognosen im Frühjahr deutlich nach oben nahmen, zog der Fonds nur zögerlich nach. In der Jahresauswertung der FTD erreichte der IWF damit Platz 46 von 50 ausgewerteten Banken und Institutionen. Zudem ist die 2006er Fehlprognose beim IWF kein Ausreißer: Als wir Ende 2005 die Prognosen der wichtigsten Banken und Institutionen seit 2002 gemeinsam auswerteten, landete der Fonds auf Platz 40 von 45.
Wie ich in diesen Tagen in Washington erfahren durfte, sind selbst die Volkswirte beim IWF etwas befremdet, welch große Aufmerksamkeit ihren Prognosen zuteil wird. Natürlich freut man sich über die Publicity. Allerdings hätte man gerne, dass die Journalisten und die Politiker weniger auf die nackten Wachstumszahlen aus Washington blicken, sondern eher einmal die Analysen zu anderen Themen, etwa zur Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen oder zur Stabilität des Finanzsystems mit ähnlicher Begeisterung aufnehmen.
Denn wie die Fondsexperten selber einräumen, sind sie bei der Wachstumsprognose nicht unbedingt besser als die großen unter den deutschen Forschungsinstituten, wie etwa das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Nur rund vier Personen arbeiten in Washington an der Deutschlandprognose – bei der Gemeinschaftsprognose der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute basteln in der Summe mehrere Dutzend Wissenschaftler an der Vorhersage. Hinzu kommt, dass den IWF-Prognostikern oft langjährige Erfahrung mit der Deutschland-Prognose fehlt. Damit sich die Ökonomen nicht zu sehr mit den Politikern und Beamten eines Landes anfreunden, was bei der IWF-Kreditvergabe nachteilig sein könnte, wechseln die Fonds-Ökonomen alle paar Jahre ihr Arbeitsgebiet. Die Experten, die derzeit am Deutschland-Desk arbeiten, haben so noch nie zuvor einen echten Aufschwung in Deutschland beobachtet – und deshalb möglicherweise auch diesmal die Wende verpasst.
Gerade Details in der Finanzpolitik oder Besonderheiten in der deutschen Statistik werden nicht an den Universitäten gelehrt und lassen sich nur durch langjährige Erfahrung erwerben. Dass etwa in Deutschland die Statistiker von Destatis einen Aufschwung zunächst systematisch unterschätzen, ist für viele Fonds-Ökonomen eine völlig neue Erfahrung. Viele der Experten in Kiel, aber auch die Volkswirte bei einigen Banken haben genau das schon im Aufschwung 1999/2000 erlebt – und können darum heute mit den Zahlen von Destatis besser umgehen. Der Fonds selber sieht deshalb seinen Vorsprung vor allem bei Themen, bei denen man von einem breiten Vergleich über viele Länder profitiert. Und das sind nun einmal nicht Konjunkturprognosen.
Anstatt wie üblich aus Berlin für die FTD über die Geschehnisse in der Weltwirtschaft zu berichten, nehme ich derzeit eine Auszeit und arbeite als Research Fellow am American Institute for Contemporary German Studies der Johns Hopkins-Universität in Washington, DC. Und weil man auch in der US-Hauptstadt viel Spannendes über Volkswirtschaft lernt, schreibe ich regelmäßig einen kurzen Brief nach Berlin.
Von Sebastian Dullien
Jetzt kommt Post aus Washington
Regelmäßige FTD-Leser kennen Sebastian Dullien und seine Beiträge zur Weltwirtschaft in der Zeitung. Derzeit ist der Kollege in Washington als Fellow an der Johns-Hopkins-University – und schickt ab und an jetzt auch mal Post ans WirtschaftsWunder. Zum Beispiel darüber, warum in den USA derzeit der sinkende Ölpreis die Schlagzeilen beherrscht. Welcome!
Post aus Washington, von Sebastian Dullien
Während sich Europa Sorgen über die Liefersicherheit seiner Energie aus Russland macht, beherrscht hier ein ganz anderes Thema die Schlagzeilen: Der rapide fallende Ölpreis. Schon bevor sich gestern Saudi-Arabien gegen Forderungen anderer Ölförderländer wandte, die Ölförderung weiter zurückzufahren, hatte der Ölpreis gegenüber seinem Höchststand im vergangenen Juli rund ein Drittel verloren. Der Widerstand aus Riad gegen weitere Förderbeschränkungen schickte den Ölpreis gestern noch einmal auf Talfahrt.
Im Schnitt liegt der Preis für eine Gallone (3,8 Liter) Benzin in den USA inzwischen wieder bei nur noch gut 2,20 $, gut ein Viertel niedriger als zu Rekordzeiten. In einzelnen Bundesstaaten fiel der Preis sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 2 $ pro Gallone. Dabei dürfte der ganze Preisverfall beim Rohöl noch gar nicht ganz bei den Konsumenten angekommen sein. Erfahrungsgemäß folgen die Benzinpreise an der Zapfsäule den Rohölbewegungen nur mit Verzögerung.
Interessant ist auch, dass trotz des Preisverfalls inzwischen der aktuelle Ölpreis sogar höher liegt als jener für die Lieferung in einigen Monaten, was darauf hindeutet, dass inzwischen auch an den Finanzmärkten mit weiter fallenden Energiepreisen gerechnet wird. Gerade dies war in den vergangenen Monaten regelmäßig nicht der Fall gewesen. Damit steigen die Chancen, dass sich der Preisverfall als nachhaltig erweist.
Für die US-Wirtschaft ist dies ein äußerst willkommener Stimulus. Gerade die heimische Autoindustrie hatte in den vergangenen Monaten extrem unter dem hohen Ölpreis gelitten. Weil die US-Industrie nur wenige spritsparende Modelle im Programm hat, litt sie stärker als die Importeure unter den gestiegenen Benzinpreisen. Zudem bekommen die Konsumenten gerade in jenem Moment Kaufkraft in die Portemonnaies gespült, in denen sie nicht mehr von kontinuierlich steigenden Immobilienpreisen profitieren. In Washington wächst so die Zuversicht, dass sich die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten von der Schwäche aus dem letzten Sommer erholt.
Welche Rolle der Benzinpreis für den durchschnittlichen Haushalt in den USA spielt, wurde mir am Wochenende wieder klar, als ich Freunde in Omaha besuchte, der Hauptstadt von Nebraska, eines vorwiegend ländliche geprägten Staates inmitten der USA. Weil mein Flugzeug etwas zu früh war, musste ich einige Zeit vor dem Flughafen warten, bis ich abgeholt wurde. Man hatte mir gesagt, ich würde von einem silbernen Minivan abgeholt. Von den Autos, die dort vorfuhren, war kein einziges ein Kleinwagen, wie wir ihn in Deutschland kennen. Sogar Mittelklassewagen oder (für deutsche Verhältnisse recht große) Minivans, noch vor 10 Jahren häufig in diesen Gegenden zu finden, waren in der Minderheit. Stattdessen dominierten große SUVs das Bild. Dafür fuhr immer wieder ein „Hummer“, ein großer Jeep, der ursprünglich fürs Militär entwickelt wurde, vorbei; ein Auto, das locker 25 Liter auf 100 Kilometern verbraucht. Und 100 Kilometer sind in Nebraska schnell gefahren. Allein der Weg vom Flughafen zum Haus meiner Freunde, gerade einmal am anderen Ende der 800.000-Einwohner-Stadt Omaha gelegen, dauerte rund 40 Minuten, und das bei leichtem Verkehr.