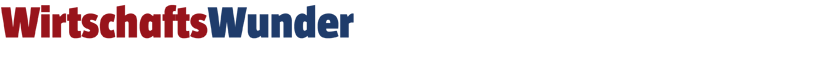Archiv
Ökonomenstreit revisited
83 VWL-Professoren hatten im Mai einen Aufruf unterzeichnet „Rettet die Wirtschaftspolitik an deutschen Universitäten“. Aufgeregte Volkswirte äußerten sich darauf im Handelsblatt und der Frankfurter Allgemeinen. Auf dem Podium beim Verein für Socialpolitik trafen Roland Vaubel, einer der vier Initiatoren des Aufrufs, und Thomas Gehrig, der den Gegenaufruf unterschrieben hatte, aufeinander.
Vaubel, Uni Mannheim, ging mit seinem Referat gleich in die Defensive und versuchte Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. In der Diskussion gehe es in erster Linie um die Tendenz zur Umwidmung von Lehrstühlen für Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft an deutschen Universitäten. Es gebe zu mehr Anreize, Spezialfälle im Modell zu untersuchen als wirtschaftspolitisch relevante Fragestellungen zu erforschen. Es sei bei dem Aufruf nicht um Ordnungspolitik, sondern um Wirtschaftspolitik gegangen, nicht um Methoden oder Mathematik, sondern um den Forschungsgegenstand. Es sei nicht um den Schutz vor internationaler Konkurrenz gegangen.
„Eigentlich geht es in der ganzen Diskussion um die Frage, wo die deutschen Unis hinwollten“, entgegnete Gehrig, Uni Freiburg und Unterzeichner des Gegenaufrufs. Theorie ist Esoterik, Politik ist die reale Welt – so lese sich der Aufruf der 83 Professoren. Tatsächlich fände in der deutschen VWL gerade ein Generationenwechsel statt. Die zunehmende Konkurrenz zwinge die Unis zur Profilbildung. Nun gehe es einige sehr wohl auch um die Frage, alte Netzwerke zu schützen.
„Die Tendenz, Lehrstühle umzuwidmen, ist ein Beleg dafür, dass die WVL wegwolle von Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft hin zu Dingen, die man nicht mehr genau definieren kann“, sagte Vaubel. Einige im Publikum lachten leise. Wenn das Wort Wirtschaftspolitik nicht in der Bezeichnung des Lehrstuhls vorkomme, gebe es keinen Anreiz, in dem Gebiet zu forschen.
Doch mit dieser Meinung stand Vaubel ziemlich alleine da. „Die traditionelle Aufgliederung der VWL in Politik, Theorie und Finanzwissenschaft ist kontraproduktiv“, sagte Gerhard Schwödiauer, Uni Magdeburg. Auch Gebhard Kirchgässner, Uni St.Gallen, war der Meinung, man solle sich nicht zu sehr an Lehrstuhlnamen „festkrallen“.
Gehrig plädoyierte dafür, in der Forschung eine theoretische Basis mit statistischen Methoden, empirischen Daten und institutioneller Kenntnis zu verbinden. Aber das bedeute auch eine Abkehr von der traditionellen Ausbildung deutscher Ökonomen. Die Bedeutung von Koautorenteams nehme zu. Doktoranden könnten besser in Graduiertenschulen auf den internationalen Wettbewerb vorbereitet werden als an einem einzigen Lehrstuhl.
An dieser Stelle könnte man Bruno Frey, Uni Zürich, das Schlusswort zukommen lassen, der sich für eine europäische Profilbildung gegenüber den anglo-amerikanischen Unis stark machte: „Junge Akademiker konzentrieren sich heute darauf, in den renommierten amerikanischen Journals zu publizieren. Deutsche Wirtschaftspolitik ist dafür völlig irrelevant. Wir müssen eigene Ideen entwickeln und dürfen nicht zweitklassige Amerikaner sein wollen.“
Von Charlotte Bartels
Gustav-Stolper-Preis 2009
Martin Hellwig ist gestern mit dem Gustav-Stolper-Preis vom Verein für Socialpolitik ausgezeichnet worden. Mit dem Preis ehrt die Ökonomenvereinigung Wirtschaftswissenschaftler, die die wirtschaftspolitische Diskussion beeinflusst und zum Verständnis der Ökonomie in der Öffentlichkeit beigetragen haben. Hellwig hatte sich im vergangenen Jahr in vielen Zeitungsartikeln und Medienbeiträgen zur aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise geäußert.
Als Sprecher des neu konstituierten Lenkungsrats Unternehmensfinanzierung vom Bundeswirtschaftsministerium hatte er sich jüngst dafür eingesetzt, dem Kaufhauskonzern Arcandor keine Staatshilfe zu gewähren.
Hellwig studierte Volkswirtschaftslehre in Heidelberg und Marburg und promovierte am renommierten MIT in den USA. Von dort führte es ihn über Stanford und Princeton zurück nach Bonn, wo er bis 1987 Professor war. Nach zwei weiteren Professuren an den Universitäten Basel und Mannheim leitet er seit 2004 das Bonner Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Außerdem war er von 2000 bis 2004 Präsident der Monopolkommission und von 2001 bis 2004 Vorsitzender des Vereins für Socialpolitik. Seit 1995 ist er Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und seit 2004 berät er die EU-Kommission in Wettbewerbsfragen.
Der Preisträger wurde von rund 3700 Vereinsmitgliedern selber gewählt, so dass die Preisvergabe auf breite Zustimmung stieß. „Ich finde es gut, dass Hellwig, der lange Zeit der international sichtbarste deutsche Ökonom war, jetzt für seine wirtschaftspolitische Leistung geehrt wird“, sagte Christoph Schmidt, Präsident des RWI Essen und seit März Mitglied des Sachverständigenrates. „Hellwig war der einzige, der sich auf der Vereinstagung vor einem Jahr überhaupt zur Finanzkrise geäußert hat.“
Schon einige Stunden vor Bekanntgabe des Preisträgers wurde beim Panel zur Bankenregulierung nach der Finanzkrise von Martin Hellwig gesprochen. Sowohl Hans Gersbach, Professor an der ETH Zürich, als auch Hans-Helmut Kotz, Vorstandsmitglied der Bundesbank, zitierten Martin Hellwig als den Ökonomen, der schon in den 1990ern auf die Schwächen der Bankenregulierung hingewiesen habe.
Wenn der Gustav-Stolper-Preis zweimal an den gleichen Ökonomen vergeben werden könnte, wäre wohl Hans-Werner Sinn wieder Preisträger geworden, der den Preis vor einem Jahr erhalten hatte. Denn viele Vereinsmitglieder meinten, dass sich Sinn nachwievor am häufigsten und am verständlichsten äußerte. Der Gustav-Stolper-Preis wurde dieses Jahr erst zum dritten Mal verliehen. Der Preisträger erhält 5000 Euro.
Aber es gab auch kritische Stimmen. „Andere Ökonomen, wie zum Beispiel Wolfgang Franz, sind schon viel länger in den Medien präsent“, sagte Horst Rottmann, Professor an der Fachhochschule Amberg-Weiden, „Hellwig hat sich erst seit der Finanzkrise zu Wort gemeldet.“ Rottmann hatte für den Wirtschaftsweisen Wolfgang Franz gestimmt.
Von Charlotte Bartels
Gossen-Preis 2009 geht an Holger Görg
Diesjähriger Gossen-Preisträger ist der Kieler Professor für International Economics Holger Görg. Mit seinen empirischen Arbeiten zum Außenhandel habe er wesentlich zum Verständnis der komplizierten Prozesse der Globalisierung beigetragen, lobte Lars-Hendrik Röller, Präsident des Vereins für Socialpolitik.
Holger Görg lieferte wichtige Beiträge zu Unternehmensentscheidungen, im Ausland zu investieren, outzusourcen oder zu exportieren und die Auswirkungen auf Produktivität und Beschäftigung.
Görgs Forschungsarbeiten seien politikrelevant, betonte Vereinspräsident Röller, der 2002 selber den Gossen-Preis erhielt. Röller hob einige Paper von Görg hervor. Bisher habe die Forschung nur horizontale Fusionen von Unternehmen untersucht. Görg habe in einem Paper die Analyse auch auf vertikale Zusammenschlüsse erweitert und so wichtige Unterschiede aufgezeigt. In einem weiteren Paper habe er am Beispiel Irlands belegt, wie extrem staatliche Exporthilfe in letzter Zeit angestiegen sei.
Der Preis, der einmal im Jahr vom Verein für Socialpolitik verliehen wird und mit 10 000 Euro dotiert ist, soll die Internationalisierung der deutschen Wirtschaftswissenschaft fördern. Der Preisträger darf nicht älter als 45 Jahre sein.
Von Charlotte Bartels
Nicht das Ende der Welt
Schmetterlingsfans sollten sich um den Klimawandel sorgen. Einige Schmetterlingsarten sind schon ausgestorben – nachweisbar aufgrund des Klimawandels. Ein wärmeres Klima hingegen könnte den Strandhotels im Baltikum mehr Gäste bringen. „Climate Change – so what?“, fragte der Umweltökonom Richard Tol mit dem zweiten Vortrag zum Konferenzschwerpunkt Klimawandel.
„Climate change is real and is a real problem, but it is not the end of the world.“
Vor allen Dingen sei der Klimawandel für die reicheren Länder, die meistens kühlere Temperaturen haben, kein so großes Problem. Schlimm werde es die ärmeren Länder treffen, sagte Tol, der momentan am Economic and Social Research Institute in Dublin arbeitet. 2007 gewann er mit dem Team von Al Gore den Friedensnobelpreis. Ärmere Länder hätten ohnehin schon heißere Temperaturen, hätten schlechtere Technologien und schlechter funktionierende Institutionen. Die reichen Länder hätten bessere Möglichkeiten, sich mit dem Klimawandel zu arrangieren. „Das Wirtschaftswachstum zu opfern um Treibhausgase zu reduzieren, ist also keine schlaue Idee“, sagte Tol.
Kanadas Wirtschaft würde sogar bis 2100 vom Klimawandel profitieren, während Ghana schon jetzt Schäden in Höhe von fünf Prozent seines Bruttoinlandsprodukts aufgrund des Klimawandels verzeichnen dürfte. Im Durchschnitt würde die Weltwirtschaft laut Prognosen ab 2050 aufgrund des Klimawandels Schaden tragen. Aber auch wenn Richard Tol Auswirkungen für die Wirtschaft überwiegend positiv einschätzte, wand er ein, dass die Mehrheit der Länder und die Mehrheit der Menschen negative Effekte des Klimawandels spüren werde.
„Better stick your money in development!“
Die Kinder und Enkel der Menschen in ärmeren Ländern würden mehr von der Reduktion des CO2-Ausstoßes profitierten, da diese Länder schlechter gegen die Auswirkungen des Klimawandels gewappnet seien. Daher sollte man lieber in Entwicklungshilfe investieren, meinte Tol.
Von Charlotte Bartels
Klimastunde für Wirtschaftswissenschaftler
Zum Auftakt der diesjährigen Tagung des Vereins für Socialpolitik wagte sich Klimawissenschaftler Mojib Latif „in die Höhle der Löwen“. Die Wirtschaft ist schließlich nicht gerade bekannt dafür, sich bei ihren Entscheidungen um das Klima zu sorgen. Doch der Klimawandel ist Schwerpunkt der Jahrestagung der Ökonomenvereinigung. In seinem Vortrag gab Latif Konferenzteilnehmern wichtige Zahlen und verschiedene Prognosen an die Hand und mahnte, selber Verantwortung zu übernehmen.
Tatsache sei, dass die Erde 0,7 Grad wärmer geworden sei seit 1900. Momentan steige der Meeresspiegel um drei Millimeter im Jahr. Zwischen 1980 und 2008 sei ein Drittel des Eises in der Arktis geschmolzen. „Aber das eigentliche Problem ist nicht heute, sondern morgen und übermorgen“, sagte Mojib Latif, Leibniz-Institut für Meereswissenschaften der Universität Kiel. Es gebe eine „Riesenbandbreite“ an Szenarien und möglichen Resultaten.
Dass sich die Erde bis 2100 um weitere zwei Grad erwärmen würde, sei jetzt schon sicher, da CO2 bis zu hundert Jahre in der Atmosphäre bleibe. Bis 2100 würde der Meeresspiegel wohl um einen Meter steigen. „Je nachdem, wie wir uns jetzt verhalten, kann es aber bis zu vier Grad wärmer werden bis zum Ende des Jahrhunderts“, so Latif. „Damit muss sich auch die Wirtschaft auseinandersetzen.“
Wenn das Eis auf Grönland eines Tages komplett geschmolzen sei, wäre der Meeresspiegel weltweit sieben Meter höher. Das könne erst in mehreren hundert Jahren eintreten, aber auch früher. Denn so ein Schmelzprozess sei dynamisch und daher extrem komplex. Das Schmelzwasser infiltriere die Gletscher, die dann auseinanderbrechen und sofort ins Meer stürzen könnten.
Viele schimpften, dass die Politiker nichts tun. Das stimme auch. „Aber eigentlich sind wir alle dafür verantwortlich“, sagte Latif, „das ist die unbequeme Wahrheit.“ Wir verbrauchten die Ressourcen so schnell, dass bald nichts mehr da sei. „Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen.“
Von Charlotte Bartels
Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2009
Ab nächsten Mittwoch können Sie an dieser Stelle die Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik verfolgen. Schwerpunktthema ist dieses Jahr die Klimapolitik.
Von Charlotte Bartels
Armin Falk holt Umfragen ins Labor
Würden Sie lieber 100 Euro mit Sicherheit bekommen oder 300 Euro mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent? Welches Risiko sind Sie bereit einzugehen? Der Bonner Ökonom Armin Falk nimmt die Teilnehmer der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik mit ins Labor der experimentierenden Wirtschaftswissenschaftler. Dort hat er untersucht, ob Umfrageergebnisse tatsächlich stichhaltig sind.
Wie risikobereit sind die Deutschen? Die Männer, die Frauen, die Kinder? Sicherlich kann man sich dieser Frage nähern, in dem man eine repräsentative Umfrage unter den Deutschen durchführt. Doch bergen diese Befragungen immer die Gefahr, dass die Teilnehmer ihre eigene Risikobereitschaft nicht richtig einschätzen oder dass sie ganz bewusst falsche Antworten geben. Viele Sozialwissenschaftler oder Ökonomen würden eigentlich solchen Umfragen nur wenig Wert beimessen: Sie ließen keine Rückschlüsse auf das tatsächliches Verhalten der Menschen zu, so die Kritik.
Doch hier kann die experimentelle Ökonomie einen wichtigen Beitrag leisten und im Labor können Wissenschaftler überprüfen, ob die in Umfragen erzielten Ergebnisse auch auf das tatsächliche Verhalten anwenden lassen. Genau das hat das Team von Armin Falk getan. Zunächst nutzten sie Umfrageergebnisse aus den Sozio-Ökonomischen Panel (SOEP). Seit 2004 werden die 22000 Teilnehmer der Langzeitbefragungen nach ihrer eigenen Risikoneigung befragt auf einer Skala von 1 bis 10.
Für die Experimente wurde nun eine ähnlich repräsentative – aber kleinere – Gruppe von 450 Menschen ausgewählt. Die Versuchsteilnehmer konnten dabei wählen zwischen einer Lotterie, in der sie 300 Euro mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit gewinnen können, und einer sicheren Auszahlung. Erst hat er 20 Euro als sichere Auszahlung geboten, dann 40 Euro, dann 60 Euro und am Ende 200 Euro. Das Wichtige dabei, die Teilnehmern haben wirklich Geld bekommen – sie hatten also einen starken Anreiz ihre wahre Risikoneigung zu offenbaren.
Für jeden Teilnehmer konnte so ermittelt werden, ab welcher Summe er oder sie zu einem sicheren Auszahlungsbetrag wechselt. Und genau so wurde die tatsächliche Risikoeinstellung ermittelt. Zuvor wurden die Teilnehmer ähnlich wie in der SOEP-Umfrage befragt, wie sie ihre eigene Risikobereitschaft einschätzen. Im Ergebnis unterschieden sich die persönlichen Einschätzungen mit der aus dem Versuch nur wenig. Die SOEP-Umfrage hat damit offensichtlich recht gute Ergebnisse erbracht.
Die tatsächliche Risikobereitschaft der Deutschen gibt wichtige Aufschlüsse, wenn es um das Gesundheitssystem geht, die Altersvorsorge und vieles mehr. Anhand der breiten Umfrage im SOEP, kann nun in einem zweiten Schritt untersucht werden, was das Risikoverhalten der Deutschen erklärt. Wird es von den Eltern geprägt oder ist es genetisch vorherbestimmt. Wie unterscheiden sich Männer und Frauen, welchen Einfluss hat die Körpergröße oder das Alter.
Falk führt aus, dass nach ähnlichen Versuchen in den USA ermittelt wurde, dass die Amerikaner (also Männer und Frauen zusammen) im Schnitt in etwa so risikobereit sind wie die deutschen Männer. Ein weitere Frage: Was bestimmt die Risikoneigung von Kindern. Werden Kinder geprägt durch die allgemeine Einstellung der Eltern? Oder ist es wichtiger, wie sich Eltern in bestimmten Fragen verhalten. Scheuen sie das Risiko, wenn es um ihre Gesundheit oder wenn es um Aktien und andere Finanzfragen geht.
Das Ergebnis: Die allgemeine Risikoeinstellung der Eltern spielt für die Neigung der Kinder eine geringere Rolle also das Verhalten der Eltern in ganz bestimmten Fragen. Wenn sich ein Ehepaar gerne riskante Aktien ins Depot legt, dürfte das in der Tendenz auch bei den Nachfahren der Fall sein. Auch wenn die Eltern im Allgemeinen eher vorsichtig sind.
Mit Charlotte Bartels
Im Supermarkt für Glaubwürdigkeit
Länder, die bei Ratings schlecht abscheiden, können sich Glaubwürdigkeit „erkaufen“, indem sie Mitglied bei internationalen Institutionen werden. Das haben Forscher aus der Schweiz herausgefunden.
World Trade Organization (WTO), International Court of Justice (ICJ) oder Court for Settlement of Investment Disputes – das Angebot von internationalen Organisationen ist groß. Und es ist ein gutes Angebot, besonders für Länder, deren Institutionen als schlecht gelten. Denn schlechte Institutionen bedeuten häufig, dass sich Investoren nicht darauf verlassen können, dass die Gesetze in dem Land eingehalten werden. Die Glaubwürdigkeit des Landes ist niedrig, die Ratings sind schlecht. Das schreckt Investoren ab.
In ihrer Studie finden Axel Dreher und Stefan Voigt nun, dass gerade Länder mit schlechten Institutionen, ihre Glaubwürdigkeit steigern können, indem sie Mitglied bei internationalen Organisationen werden. Je länger sie Mitglied sind, desto besser fällt das Rating der einzelnen Länder aus.
„China konnte beispielsweise seine Glaubwürdigkeit steigern, seitdem es WTO-Mitglied ist“, sagte Axel Dreher. Denn nun hielten Investoren die Versprechungen der Regierung für glaubwürdiger. Jetzt würde das Land ja zusätzlich den Regeln der WTO unterstehen.
Für ihre Studie haben die Wissenschaftler Daten aus 120 Ländern von 1982 bis 2004 ausgewertet. Die Glaubwürdigkeit haben sie anhand des Länder-Risikoratings von Euromoney gemessen. Die Qualität der Institutionen zeigte ein „Law and Order“-Indikator, der die Wahrnehmung der Rechtssicherheit von Länderexperten widerspiegelt.
Für OECD-Länder ließ sich der Zusammenhang zwischen Glaubwürdigkeit und Mitgliedschaft in internationalen Organisationen allerdings nicht nachweisen. Denn je höher die Qualität der eigenen Institutionen ist, desto geringer fällt der Effekt einer weiteren Mitgliedschaft auf die Glaubwürdigkeit aus.
Bis zu einer bestimmten „Glaubwürdigkeits-Schwelle“ können Länder also die Reform ihrer eigenen Institutionen durch die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen ersetzen.
Hier finden Sie die Studie
Von Charlotte Bartels
Axel Ockenfels will Rachefeedback bei Ebay bekämpfen
Der Kölner Professor Axel Ockenfels hat mit seinen Experimenten herausgefunden, wie man Rachefeedback auf Ebay reduzieren kann. Keiner kann mit dem neuen System einen User bestrafen, der einen Verkäufer zum Beispiel nach der wahren Qualität der Lieferung usw. bewertet.
Mit seinen Versuchen hat Ockenfels herausgefunden, wie sich bei der Onlineplattform Ebay ein besseres Bewertungssystem einrichten lässt. Das alte System ermöglichte es, den Käufern und den Verkäufern sich gegenseitig sofort zu bewerten. Es habe eigentlich ganz gut funktioniert, sagte Ockenfels in seinem Vortrag. Gut 70 Prozent aller User gaben nach ihrem Einkauf ein Feedback ab.
Dass Problem dabei: Wer einen Verkäufer negativ bewertet, riskierte selber, negativ bewertet zu werden. Ein typisches Rachefeedback. Im Resultat dürfte es zu viel positives Feedback bei Ebay gegeben haben, sagte Ockenfels. Die wahren Mängel der Verkäufer könnten so verdeckt worden sein.
Dadurch sind in einem hochsensiblen Kern der Auktionsplattform möglicherweise Verzerrungen aufgetreten. Denn das Bewertungssystem ist doch der erste Anhaltpunkt für User, die das erste Mal bei einem Verkäufer etwas erstehen wollen.
Als Lösung würde sich anbieten, die Bewertung ohne das Wissen des Anderen laufen lassen. Für eine gewisse Zeit, vielleicht zwei Wochen nach dem Kauf, hätte jeder Nutzer die Möglichkeit, den Verkäufer zu bewerten, ohne dass der andere es sofort erfährt. Der Verkäufer hätte so auch keine Möglichkeit mehr für eine Rache. Diese Variante würde jedoch die Zahl der Bewertungen drastisch senken, hat Ockenfels herausgefunden.
Eine bessere Möglichkeit sei, so hat sich in den Versuchen herausgestellt, dass man dem herkömmlichen Bewertungssystem ein anonymes hinzufügt. Also dass es weiterhin eine Gesamtbewertung wie bisher gibt, die nach positivem, neutralem und negativem Feedback unterscheidet. Zusätzlich kommen ein paar Detailfragen hinzu, zum Beispiel ob die Qualität des Produkts tatsächlich so war wie in der Beschreibung angegeben. Doch diese Antworten erfährt der andere nicht.
Versuche hätten wiederum ergeben, dass die User in ihren öffentlichen Bewertungen deutlich freundlicher sind, als in den anonymen, in denen sie eher ihre wahre Meinung mitteilten. Gleichzeitig würde aber die Zahl der Bewertungen nicht zurückgehen.
So demonstrierte Ockenfels, wie experimentelle Ökonomie bei der Ausgestaltung von Märkten im alltäglichen Leben einen praktischen Beitrag leisten kann.
Angst vor Outsourcing
Herr Müller, ihren Job macht ab morgen Herr Kanbur in Indien. Outgesourct. Job ins Ausland verlagert. Zurück lassen die Unternehmen Angst. Angst, dass der eigene Job bald von einem Ausländer gemacht wird. Wie sich Outsourcing auf die Angst vor dem Jobverlust auswirkt, hat Ingo Geishecker von der Uni Göttingen untersucht. Wer sich am meisten um seinen Arbeitsplatz sorgt, erfahren sie hier.
Mit den Daten des deutschen sozio-ökonomischen Panels (GSOEP) hat Ingo Geishecker herausgefunden, dass rund ein Fünftel der Jobverlustangst durch Outsourcing entsteht. Diese Angst habe in den letzten Jahren zugenommen.
Niedriglohnländer
Wenn die Unternehmen die Jobs in Niedriglohnländer verlagern, erzeuge das mehr Angst, als wenn die Verlagerung in Hochlohnländer stattfinden würde.
Hochqualifizierte
Hochqualifizierte fürchteten sich mehr vor dem Outsourcing als Niedrigqualifizierte. Das könne daran liegen, dass sie besser informiert seien und mehr zu verlieren haben, so Geishecker.
Eheleute
Männer, die verheiratet sind, machen sich größere Sorgen als Unverheiratete. Wenn der Partner auch einen Arbeitsplatz hat, machen sich Männer wie Frauen weniger Gedanken.
Befristete Verträge
Outsourcing plus befristeter Vertrag ist keine gute Mischung, sondern bedeutet mehr Angst als bei einem unbefristeten Vertrag.
Aus der Angst vor Outsourcing kann schnell Angst vor der Globalisierung werden, warnt Ingo Geishecker. In den USA sei dies bereits erkennbar: Es gebe dort immer mehr Initiativen, die sich für protektionistische Maßnahmen gegen die Globalisierung einsetzten.
Hier geht es zur Studie
Von Charlotte Bartels
Ernst Fehr: Geldillusion neurowissenschaftlich nachgewiesen
Ernst Fehr, Professor aus Zürich, hat schon vor Jahren in Experimenten gezeigt, dass Menschen sich eher an nominalen Löhnen oder Preisen orientieren als an realen, also den inflationsbereinigten. Diese Geldillusion kann Blasen an Finanzmärkten, Immobilienmärkten aber auch die negativen Folgen einer zu restriktiven Geldpolitik erklären. In Graz zitierte Fehr nun eine Studie, die die alte Vorstellung von Keynes sogar neurowissenschaftlich bewiesen haben will.
So hat Fehr in seinen Experimenten zusammen mit Jean-Robert Tyran bestätigt, dass sich Preisanpassungen nach unten in einer Volkswirtschaft meist sehr langsam vollziehen. Nach oben geht das jedoch rasend schnell.
Vereinfacht ausgedrückt: Wenn eine Zentralbank die Geldmenge durch Zinserhöhungen einschränken will, um so die Inflation unter Kontrolle zu halten, müssten sich auch die realen Preise und Löhne einer Volkswirtschaft anpassen und zwar nach unten. Nur passiert dies in Regel sehr, sehr langsam, wie Fehr und Tyran in ihren Versuchen gezeigt haben.
Das sei damit zu erklären, dass sich die Individuen lieber an nominalen Größen orientieren, als an realen. Wie Umfragen gezeigt hätten, würde Arbeitnehmer eher einen Lohnanstieg um 2 Prozent akzeptieren bei einer Inflationsrate von 4 Prozent, als dass sie eine Lohnsenkung von 2 Prozent bei einer Teuerung von 0 Prozent gut heißen würden. Nominal haben sie das eine Mal ein Plus, das andere Mal ein Minus. Real sind die Effekte jedoch gleich: minus 2 Prozent.
Selbst wenn die Mehrheit der Wirtschaftssubjekte sich an realen Größen orientiere: Es reicht schon eine Minderheit, die der Geldillusion unterliegt. Denn diese habe große Wirkung auf die Gesamtheit der Individuen. Wenn nur wenige mit ihren Preisen und Löhnen nicht herunter gehen wollen, passten sich auch die rationalsten Individuen an dieses Verhalten an.
Das Resultat der Studien: Eine zu lockere Geldpolitik habe nur geringe negative Folgen. Eine zu restriktive jedoch verursucht enormen volkswirtschaftlichen Schaden. Besser kann man die unterschiedlichen Auffassungen bei den Währungshütern von EZB und der amerikanischen Fed gar nicht erklären. Während die Europäer mitten in der Krise ihre Zinsen anhoben und damit nach Auffassung nicht weniger Ökonomen den Abschwung in der Euro-Zone verstärkten,
lockerten die Amerikaner nach Ausbruch der Finanzkrise ihre Geldpolitik sehr drastisch.
Dabei wollte Fehr vor gut sieben Jahren eigentlich nachweisen, dass es gar keine Geldillusion bei den Wirtschaftssubjekten gibt, wie er in seinem Vortrag erklärte. Dies sei ja die seit den 70er Jahren die vorherrschende Vorstellung unter den akademischen Volkswirten gewesen. Die alte intuitive Annahme von Keynes, die noch in den 50er und 60er Jahren viele Ökonomen vertraten, hatte mit dem Vordringen der Theorien rationaler Erwartungen rapide an Einfluss verloren. Im Resultat, sagte die neue Richtung Anfang der 70er Jahre, dass die Geldpolitik keinen Einfluss auf reale volkswirtschaftliche Größen hat.
Nun sagen die Forschungsergebnisse von Fehr und anderen zwar nicht, dass eine expansive Politik einen Abschwung verhindern kann. Jedoch bestätigen die Experimente immerhin die negativen Folgen einer zu restriktiven Zinspolitik. Eine noch nicht veröffentlichte Studie habe zudem gezeigt, dass das Festhalten an nominalen Größen, sogar neurowissenschaftlich bestätigt wurde. In einem demnächst zu veröffentlichenden Paper seien die Ergebnisse zu finden: „Nominal Illusion is Real: The brain reward’s circuitry is sensitive to nominal change“ von Bernd Weber, Antonio Rangel and Matthias Wibral und Armin Falk – dem diesjährigen Gossen-Preisträger.
Von dicken Katzen auf blauen Bananen
Dicke Katzen – das sind die Länder mit hohen Steuereinnahmen aus ihren großen Industrieunternehmen. Man findet sie zum Beispiel in Westeuropa. Dünne Katzen wohnen in Osteuropa. Dort gibt es noch wenig Industrieunternehmen, die Steuerfutter abwerfen. Wohin der Steuerwettbewerb zwischen dicken und dünnen Katzen führen wird, erklärt Professor Kai Konrad vom Wissenschaftszentrum Berlin.
Bis jetzt siedeln die großen Industrieunternehmen noch in Westeuropa. Von Manchester über London, die Benelux-Staaten, das Ruhrgebiet, das Rhein-Neckar-Gebiet bis nach Mailand – wenn man die Industriegebiete miteinander verbindet, sieht das aus wie eine Banane. Aber die osteuropäischen Länder schlafen nicht und haben längst ihre Steuern gesenkt um neue Investitionen anzulocken.
Die dicken Katzen, die Industrieländer Westeuropas, haben hohe Steuereinnahmen aus den Industrieunternehmen, die seit Jahrzehnten in ihrem Land produzieren. Damit die Industrieunternehmen nicht ins billige Osteuropa abwandern, müssten sie ebenfalls ihre Steuern senken. Aber mit Steuersenkungen schaden die Länder sich selbst, weil sie damit ihre Einnahmen aus den alten Unternehmen reduzieren. Dicke Katzen haben also einen strategischen Nachteil im Steuerwettbewerb gegenüber den dünnen Katzen. Die dicke Katze kann sich nur schwer bewegen, weil sie so viel Masse hat.
Letztendlich werden aber beide, dicke und dünne Katzen, ihre Steuern stark senken, schlussfolgert Konrad aus seinem Modell. Das Steueraufkommen wird massiv sinken. Schließlich wird der Wettbewerb um neue Direktinvestitionen nur noch darüber betrieben, wieviele Subventionen den neu investierenden Unternehmen gewährt werden. Weil die dicken Katzen mehr Geld haben, werden die Industrieunternehmen da bleiben, wo sie sind, sagt das Modell voraus.
Das Paper lesen Sie hier
Von Charlotte Bartels
Der Klima-Club
Was kommt nach dem Kyoto-Protokoll? Züricher Forscher haben sich ein „Globales Rückerstattungssystem“ ausgedacht. Die Länder müssen eine Beitrittsgebühr zahlen und kriegen dann Geld zurück für die Einsparung von Treibhausgasen. Wie diese Art „Klima-Club“ genau funktionieren soll, lesen sie hier.
Wie kriegen wir die Länder dieser Welt dazu, dauerhaft ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren? Ralph Winkler und Hans Gersbach von der ETH Zürich wollen das ein bißchen so machen wie ein Besitzer eines teuren Nachtclubs. Man fordere eine so hohe Eintrittsgebühr, dass die Leute die ganze Nacht im Club bleiben, um möglichst viel vom teuren Eintritt zu haben. Denn die Gebühr gibts nicht zurück beim Verlassen des Clubs.
So wollen auch die Züricher Forscher die Länder an den Klima-Club, das „Globales Rückerstattungssystem“, binden. Die Länder zahlen beim Beitritt eine hohe Summe in den Fond ein. In jeder neuen Periode legt der Fond einen Anteil fest, der an die Länder ausgeschüttet wird. Je nachdem, wieviel Treibhausgase die einzelnen Länder eingespart haben, kriegen sie etwas von der Auschüttung ab.
Die Eintrittsgebühr muss ausreichend hoch sein, damit keiner wieder austritt, so Ralph Winkler. Aber da gibt es auch schon das erste Problem: einige Entwicklungsländer werden sich die hohe Eintrittsgebühr nicht leisten können und so außen vor bleiben.
Ein weiteres Problem findet sich in der Literatur der Spieltheorie: Demnach kommen Koalitionen zwischen mehr als vier Teilnehmern gar nicht erst zustande. „Free-Riding“, also alleine zu handeln, sei bei mehr als vier Ländern immer besser, als einem Abkommen beizutreten.
Das System der Züricher Forscher hindert die Länder vielleicht daran, wieder auszutreten und sorgt so für ein dauerhaftes Engagement gegen den Klimawandel. Aber ob die Länder überhaupt eintreten? Ralph Winkler hofft auf eine Vorbildfunktion beispielsweise der EU. „Wenn die erstmal anfängt, dann kommen die anderen Länder vielleicht nach und nach dazu.“
Das Paper finden Sie hier
Von Charlotte Bartels
Ein Treffen von Sozialpolitikern in Graz?
Der Name der Vereinigung mag es nahe legen, dass sich hier Sozialpolitiker zu ihrer jährlichen Tagung treffen. Zwei österreichische Politiker nahmen das jedoch zu wörtlich und riefen auch noch dazu auf, das Kreuz am Sonntag bei der richtigen Partei zu machen.
Der Vorsitzende des Vereins für Socialpolitik, Friedrich Schneider, konnte sich am Ende der Politikerreden auf dem Empfang der Stadt Graz und des Landes Steiermark doch nicht mehr zurückhalten. „Wir machen nicht nur Sozialpolitik“, sagte er den beiden prominenten Politikern. Der Bürgermeister hatte seinen Stellvertreter geschickt und der Vize-Landeshauptmann war auch erschienen.
Der eine betonte, was es für eine Ehre für ihn sei, dass er als jemand, der aus der Sozialpolitik komme, die Teilnehmer der Tagung begrüßen dürfe. Der andere lobte die Früchte der Sozialstaates, und dass der Zusammenhalt der Gesellschaft nur durch ihn garantiert sei. Und damit das so bleibt, sollten doch die Herrschaften bitte ihr Kreuz am Sonntag bei der Wahl in Österreich auch bei der richtigen Partei machen.
„Wir sind die Vereinigung der Ökonomen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz“, klärte Schneider dann die Politiker auf. Die Volkswirte, die meisten kommen aus Deutschland, schauten sich nur amüsiert an, bevor das Büffet dann endlich eröffnet wurde. Es ist übrigens nicht bekannt, ob einige Ökonomen beim Essen sich auch über die Niedriglohnmodelle des diesjährigen Stolper-Preisträgers unterhielten.
Gossenpreis geht dieses Jahr an Armin Falk
Dem Bonner VWL-Professor Armin Falk wurde heute der Gossen-Preis des Vereins für Socialpolitik verliehen. Falk hat mit seinen Arbeiten die Annahmen des „Homo oeconomicus“ in Frage gestellt, die bis heute in vielen Theorien der Volkswirtschaftslehre unterstellt werden. Denn in der Regel verhalten sich die Menschen gar nicht rational und egoistisch wie der „Homo oeconomicus“, sondern durchaus sozial und fair. Das fand Falk mit Experimenten heraus.
Der 40-jährige Armin Falk ist einer der international erfolgreichsten deutschen Ökonomen. Er publizierte mehrfach Aufsätze in den angesehenen Fachzeitschriften wie „American Economic Review“, Quarterly Journal of Economics“ und „Econometrica“.
Falk beschäftigt sich aber nicht nur mit Experimenten: „Die jüngsten Turbulenzen auf den Finanzmärkten haben das Vertrauen in die Macht der Märkte tief erschüttert“, sagte Armin Falk am Rande der Tagung zu den aktuellen Unruhen. Besonders weil das Finanzsystem bisher dafür bekannt gewesen sei, dass es gut funktionierende Märkte hervorgebracht habe. „Wenn jetzt auch noch die Finanzmärkte zusammenbrechen, würden viele Bürger anfangen, Märkte auch generell in Frage zustellen“, so Falk. Der Vertrauensverlust könne auch dazu führen, dass politische Kräfte erstarken, die die Rolle der Märkte beschränken wollen.
Zur experimentellen Ökonomie sagte er: Ähnlich wie die Volkswirte zunehmend Laborversuche nutzten, um ihre Theorien zu fundieren, sollten auch Politiker neue Reformen, wie etwa am Arbeitsmarkt, erst einmal testen – und das nicht im Labor sondern in der Wirklichkeit. „Wir brauchen mehr soziale Experimente“, sagte Falk. Viele Maßnahmen hätten weitreichende Bedeutungen für die Bürger, deswegen müssten die Reformen teilweise besser implementiert werden.
Mit dem Gossen-Preis wird einmal jährlich ein Wirtschaftswissenschaftler aus dem deutschen Sprachraum ausgezeichnet, der mit seiner Arbeit internationales Ansehen gewonnen hat. Dafür zieht der erweiterte Vorstand des Vereins für Socialpolitik, der den Preisträger wählt, die Publikationen in angesehenen internationalen Zeitschriften zu Rate und insbesondere die Häufigkeit der Nennungen im „Social Science Citation Index“. Benannt ist der mit 10.000 € dotierte Preis nach dem preußischen Nationalökonom Hermann Heinrich Gossen.
Mitarbeit: André Kühnlenz
Von Charlotte Bartels