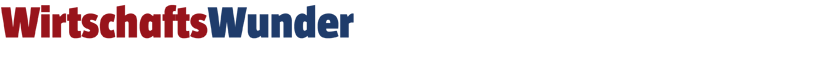Lawrence Summers – Globalisierung für alle
Die internationalistische Wirtschaftspolitik der USA verliert ihren Rückhalt, weil die Wähler für sich keine Vorteile mehr darin erkennen können. Teil eins eines Weckrufs.
Die Finanzkrise beherrscht die Debatten zur US-Konjunktur. Doch dahinter wird die Frage immer wichtiger, in welche Richtung Amerika künftig bei der Globalisierung steuert.
Seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind die USA für eine integrierte Weltwirtschaft eingetreten. Die Entwicklung in armen Ländern, speziell in Asien, wurde dadurch in nie da gewesenem Maß angeregt.
Inzwischen wird aber immer fraglicher, wie sehr Amerika hinter einer internationalistischen Wirtschaftspolitik steht. In den nächsten Monaten wird die Arbeitslosigkeit wohl deutlich steigen, doch bereits jetzt sind die Signale beunruhigend: Präsidentschaftskandidaten greifen die Freihandelszone Nafta an, das Freihandelsabkommen mit Kolumbien verkümmert, die Attacken gegen ausländische Investitionen nehmen zu. Der Zuspruch zu einer strengeren Einwanderungspolitik wächst.
Es gibt darauf eine konventionelle Antwort, die vier Standardelemente hat. Erstens wird den Skeptikern erklärt, wie viele Vorzüge der Handel hat – nicht nur für Exporteure, sondern für Verbraucher und die Wirtschaft generell.
Zweitens wird versichert, dass das strittige Handelsabkommen nicht nur auf der klassischen Wirtschaftstheorie von den komparativen Vorteilen fußt, sondern dass es auch guter Merkantilismus ist. Der Grund ist, dass die Handelsschranken der USA bereits sehr niedrig sind und normalerweise nicht so stark gesenkt werden müssen wie beim Vertragspartner. Manchmal wird noch gesagt, dass wir im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsmächten stehen und im Nachteil sind, wenn ein Entwicklungsland mit denen ein Freihandelsabkommen schließt, aber mit uns nicht.
Zum Dritten wird dem Skeptiker vermittelt, dass die zunehmende Einkommensungleichheit in der US-Wirtschaft eine Folge neuer Technologien sei, weniger von verstärktem Handel. Auch wenn der Handel eine Rolle spiele, so heißt es, sei der Großteil der Handelszunahme nicht auf Handelsabkommen zurückzuführen.
Viertens folgt ein Eingeständnis: Handelsabkommen sind gut für die Gesamtwirtschaft, aber nicht jeder profitiert. Daher wird eingeräumt, dass mehr getan werden muss, um die Ungleichheit und Unsicherheit der Einkommen zu verringern. Zuletzt hat man erkannt, dass dazu breit angelegte Maßnahmen nötig sind, etwa in den USA eine Krankenversicherung für alle.
All diese Punkte haben den großen Vorteil, dass sie wirtschaftlich korrekt sind. Insgesamt belegen sie überzeugend, dass die USA mit Handelsabkommen besser fahren als ohne und dass die Welt durch eine wachsende Verzahnung der Wirtschaft reicher und sicherer wird. Es ist sehr gut möglich, dass die Unterstützung für wirtschaftlichen Internationalismus aufrechterhalten werden kann, sofern man sich mit genug Einsatz für die an den Rand Gedrängten engagiert.
Aber ich fürchte, die Debatte wird sich einem grundlegenderen Thema widmen müssen: Viele Menschen hegen den Verdacht, dass der zentrale Punkt internationalistischer Wirtschaftspolitik – der wachsende Wohlstand der Welt – womöglich gar nicht in ihrem Interesse ist.
Paul Samuelson wies vor Jahren darauf hin, dass die gültige These, Handelsschranken schadeten einer Wirtschaft, nicht automatisch bedeute, dass die Wirtschaft vom Erfolg der Handelspartner profitiert. Wenn sich andere Länder weiterentwickeln, profitieren US-Hersteller davon, in größere Märkte verkaufen zu können. Gleichzeitig wächst aber auch die Konkurrenz. Es lässt sich nicht a priori sagen, was überwiegt. Es gibt aber Grund zu der Annahme, dass sich der wirtschaftliche Erfolg des Auslands künftig als Problem für Amerikas Arbeiter erweisen wird.
Erstens exportieren Entwicklungsländer zunehmend Güter, die auch in den USA im großen Stil produziert werden, etwa Computer. So steigt der Lohndruck. Zugleich steigert der zunehmende globale Wohlstand die Einnahmen ohnehin gut bezahlter Hersteller von geistigen Eigentum wie etwa Filmen. Hier sind die USA im Vorteil. Zweitens steigt durch den Aufstieg von Ländern wie China der Wettbewerb um Energie und Umweltressourcen, was für Amerikaner zu steigenden Preisen führt.
Drittens – und das ist der wichtigste Grund – fördert das Wachstum der Weltwirtschaft die Entwicklung einer staatenlosen Elite, die sich dem globalen Forschritt und ihrem eigenen Wohlstand verschrieben hat statt den Interessen des Landes, in dem sie ansässig ist. Ein Konzernchef sagte es dieses Jahr in Davos so: „Uns wird es gut gehen, egal, wie es Amerika geht. Aber ich hoffe um des Landes Willen, dass es die Steuern senkt, die Regulierung zurückschraubt und junge Menschen stärker drängt, die Ausbildung zu erwerben, die nötig ist, damit die USA wettbewerbsfähig bleiben.“
Der Konzernchef war aufrichtig, und er sprach eine wichtige Wahrheit aus. Selbst wenn durch die Globalisierung Ungleichheit und Unsicherheit zunehmen, wird sie ständig und oft zu Recht als Argument angeführt gegen die Machbarkeit progressiver Steuern, die Unterstützung von Gewerkschaften, gegen starke Regulierung und ein umfangreiches Angebot öffentlicher Güter, die ihre negativen Auswirkungen abfedern.
In einer Welt, in der Amerikaner zu Recht bezweifeln dürfen, ob der Erfolg der Weltwirtschaft gut für sie ist, wird es immer schwieriger, Unterstützung für Wirtschaftsinternationalismus zu mobilisieren. Der Fokus muss sich verlagern vom traditionell definierten Internationalismus zu einem, der die Interessen der Arbeiter- und der Mittelschicht in den reichen Ländern besser in Einklang mit dem Erfolg der Weltwirtschaft bringt. Mehr dazu in der nächsten Woche.