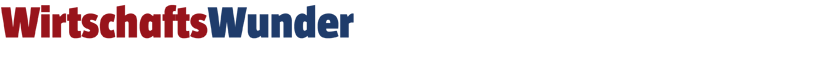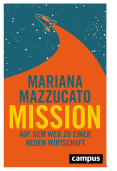… Interbankensätze
Nichts fürchten Banken mehr als verliehenes Geld nicht wieder zu sehen. In Zeiten der Finanzkrise hat selbst ihr Vertrauen untereinander gelitten. Das zeigen auch die Interbankensätze.
Interbankensätze bezeichnen die Zinssätze, zu denen Banken sich untereinander Geld leihen. Ihre Höhe hängt wesentlich davon ab, wieviel Geld im Markt verfügbar ist und für wie lange es vergeben wird. Weltweit gibt es eine Reihe veröffentlichter Interbankensätze. Zu den wichtigsten zählen Euribor und Libor.
Der Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ist der Zinssatz für Termingelder in Euro auf dem Interbankenmarkt. Der Libor (London Interbank Offered Rate) ist der Zinssatz, zu dem sich in London ansässige Geschäftsbanken in verschiedenen Währungen und für bestimmte Laufzeiten Geld leihen. Jeden Werktag meldet eine Auswahl von Kreditinstituten die Höhe ihrer Zinssätze an einen Informationsanbieter, der Durchschnittswerte ermittelt und veröffentlicht.
Im Gegensatz zu den Leitzinsen der Zentralbanken sind Interbankensätze nicht verbindlich, sondern zeigen an, welche Zinshöhe im Markt üblich ist. Trotzdem gelten die Euribor- und Libor-Zinssätze für einen Zeitraum von drei Monaten als wichtige Orientierungsmarken für viele andere Kreditzinsen, etwa für Unternehmen und Verbraucher. Dadurch beeinflussen sie letztlich den gesamten Geldkreislauf.
Der Ausbruch der Immobilienkrise in den USA im Sommer 2007 hat auch den Interbankenmarkt kräftig durchgerüttelt. Finanzinstitute fürchten, dass mögliche Geschäftspartner in hoch riskante Subprime-Papiere investiert haben und womöglich pleite gehen. Banken verleihen seitdem ungern Geld untereinander, besonders für längere Zeit.
Erst recht nach der spektakulären Pleite der Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008. In weniger als vier Wochen rauschte der Drei-Monats-Libor für Dollar-Ausleihungen von 2,81 auf 4,81 Prozent, der entsprechende Euribor erhöhte sich von 4,96 auf 5,39 Prozent.
Regierungen vieler Länder eilten herbei, um Banken mit gewaltigen Geldspritzen vor befürchteten Zusammenbrüchen zu retten. Um das gefährliche Klima aus Liquiditätssorgen und Misstrauen zu entspannen, pumpten die Notenbanken hunderte Milliarden Euro in den Finanzsektor. Außerdem senkten sie kontinuierlich ihre Leitzinsen.
So auch am 4. Dezember, als die EZB ihren Leitzins um 75 Basispunkte auf 2,5 Prozent herunterschraubte. In den USA notierte der Leitzins bei einem, in Großbritannien bei zwei Prozent. Zumindest auf dem Interbankenbank scheinen sich derzeit die ersten Erfolge abzuzeichnen: Die Zinssätze fallen und fallen. Der Libor lag am 5. Dezember bei 2,2 Prozent, der Euribor bei 3,56 Prozent.
Ob tatsächlich Ruhe unter den Banken einkehrt, lässt sich allerdings nicht so einfach sagen. Als wichtiger Indikator gilt die Differenz zwischen Leitzins und entsprechendem Interbankensatz, der sogenannte Spread. Je größer der Unterschied, um so höher die Risikoprämie, die Banken verlangen. Vor der Kreditkrise lag der Spread bei 0,5 Prozentpunkten, in ruhigeren Zeiten noch niedriger.
Sagen Sie, dass Interbankensätze nicht nur den Geldfluss zwischen Finanzinstuten, sondern auch innerhalb der gesamten Wirtschaft beeinflussen.