Kehrseiten eines Sparbrötchen-Aufschwungs
Wahlzeit ist Bilanzzeit, gelegentlich allerdings eher grobschlächtiger Art. So wie jetzt, kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag. Dabei wäre es gerade jetzt ziemlich hilfreich, genauer hinzusehen, wie stark Deutschlands ach so starke Wirtschaft wirklich ist. Das Ergebnis könnte ernüchternd ausfallen – ernüchternder jedenfalls, als es der latente Überschwang nicht nur auf manchem Wahlplakat im Land vermuten lässt. Die Deutschen bekommen derzeit zunehmend die gefährlichen Kehrseiten eines Sparbrötchen-Aufschwungs zu spüren. Stoff genug für die nächste ganz große Krise in ein paar Jahren.
Klar, ist die deutsche Wirtschaft vergleichsweise robust durch die turbulente Zeit seit 2009 gekommen, gibt es trotz Krise noch Wachstum, liegt die Arbeitlosigkeit heute deutlich niedriger als vor ein paar Jahren. Und es gibt sogar Anzeichen, dass mit der allmählichen Erholung in den USA und Europa auch die deutsche Wirtschaft gerade vor einer konjunkturellen Besserung steht.
Vieles davon sieht aber vor allem deshalb so gut aus, weil es Anderen so viel schlechter geht. Wenn Andere um mehrere Prozent schrumpfen, wie die Griechen, fällt nicht so auf, dass auch die deutsche Wirtschaft jetzt im zweiten Jahr in Folge kaum noch gewachsen ist (um jeweils deutlich weniger als ein Prozent), der einst zweistellig wachsende Export aufgehört hat zu boomen und die Arbeitslosigkeit schon seit geraumer Zeit nicht mehr weiter gefallen ist.
Noch bedenklicher ist: Inmitten dieses angeblich so starken Wachstums haben Deutschlands Unternehmen vor mehr als zwei Jahren aufgehört, ihre Investitionen in die Zukunft aufzustocken – und das trotz rekordniedriger Zinsen. Die Ausgaben für Maschinen und Anlagen sind im Gegenteil um mittlerweile mehr als sechs Prozent zurückgefahren worden – mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Angst vor einer Eskalation der Euro-Krise. Ein Alarmsignal. So bereitet man keine Zukunft vor.
Der Finanzminister stünde auch bei weitem nicht so gut da, wenn die Deutschen – anders als es das Dauergejammer vermuten lässt – nicht nach wie vor Krisengewinnler wären. Nach Schätzungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft von dieser Woche mussten wir für die Rettung Griechenlands (und damit auch von uns) bislang schlimmstenfalls zehn Milliarden Euro aufwenden. Dem stehen Zinsgewinne aus den Darlehen gegenüber – und vor allem die enormen Einsparungen für den Finanzminister, die sich als Gegenstück zum Drama im Süden durch die teils panische Flucht der Anleger in deutsche Staatsanleihen ergeben haben. Je nach Schätzung hat Wolfgang Schäuble dadurch einen Krisengewinn von 50 bis 80 Mrd. Euro einstreichen können. Krisensaldo für Deutschland: positiv. Kein wirklich schöner Weg, die eigenen Staatsfinanzen aufzuhübschen. Wenn man böse wäre, würde man sagen: kein Wunder, dass die deutsche Regierung nicht mehr getan hat, die Krise der betroffenen Länder schneller zu lösen (aber wir sind natürlich nicht böse).
Die derart gesunkenen Staatsdefizite können dann auch kein Ausdruck dafür sein, dass dies Ausdruck einer irgendwie erfolgreichen Politik war und Deutschland somit auf dem richtigen Weg ist.
All diese Mängel und Schönheitsfehler lassen an dem ach so schönen Märchen zweifeln, wonach die Deutschen einfach protzen vor Stärke, weil sie in den vergangenen Krisenjahren so heroisch reformiert und verzichtet haben (was ohnehin ja nur bedingt stimmt – in Wirklichkeit gelten die meisten Arbeitsmärkte im Ausland nach klassischem Maßstab immer noch als flexibler, und auch die Sparanstrengungen sind in den Euro-Krisenländern heute um ein Vielfaches größer als einst in Deutschland).
Eine etwas weniger romantische Erklärung des Wachstums der vergangenen Jahre lautet: Deutschland war nie so schwach, wie es sich zeitweise gejammert hat, hat Mitte der 2000er-Jahre nur endlich die Nachwehen der ökonomisch teuren Einheit hinter sich lassen können, dann viel Nachholbedarf gehabt und enorm davon profitiert, dass (vor der Krise) alle Welt sorglos expandierte und deutsche Waren kaufte, zumal die Nachfrage nach Maschinen und Anlagen – der ewigen Königsdisziplin deutscher Mittelständler – just zu dieser Zeit weltweit boomte. In so einem Umfeld konnten die Deutschen dann noch jenen Vorteil ausspielen, der sich tatsächlichen auf Kostenseite aus jahrelangem Verzicht gegenüber der Konkurrenz ergeben hatte. Hier dürfte die Agenda 2010 eine zusätzliche verstärkende Aufschwungrolle gespielt haben – nicht mehr und nicht weniger. Die deutschen Lohnstückkosten sanken dank Hartz-IV und anderem viel länger, als es die Konjunktur sonst bewirkt hätte.
Gerade hier liegen aber auch die Tücken.
Der enorme wirtschaftspolitische Schwerpunkt auf das Pushen der Wettbewerbsfähigkeit über Kostenabbau erklärt mit einiger Wahrscheinlichkeit, warum deutsche Unternehmen ihre Investitionen zugleich so wenig ausgeweitet haben – und auch erschreckend wenig in Ausbildung investiert haben. Wer die Konkurrenz über den Preis verdrängt, ist weniger unter Druck, in Produktivität zu investieren. Der starke Exportfokus der Wirtschaftspolitik hat volkswirtschaftlich vor allem zu einer entsprechend extremen Abhängigkeit der Wirtschaft von der Konjunktur im Rest der Welt geführt – die deutsche Exportquote ist in einem Jahrzehnt von einem Drittel auf mehr als 50 Prozent hochgeschnellt. Das ist toll, wenn es überall auf der Welt prima läuft, wie zwischen 2005 und 2007. Wie die jüngste Zeit gezeigt hat, ist die globale Nachfrage nach deutschen Waren nur nichts, worauf wir abonniert sind. Da verkehren sich die Vorzeichen eben auch entsprechend rapide. Die Euro-Krise hat gereicht, um Deutschlands Exportboom komplett und jäh zu stoppen. Jetzt gibt es erste Anzeichen für eine Erholung in manchem Euro-Krisenland – aber ernste Absturzsignale aus Schwellenländern, die bisher noch stützend wirkten. Höchst wackelig. Nicht wirklich eine stabile Grundausstattung.
Die Kehrseiten der Sparbrötchen-Strategie machen sich spätestens jetzt gleich mehrfach bemerkbar. Plötzlich fällt auf, dass Fachkräfte fehlen. Und in welch desolatem Zustand Straßen, Brücken und Kanalisationen in Deutschland sind – nach vielen Jahren, in denen die Regierungen wie blind versucht haben, jedes Jahr kurzsichtige Vorgaben eines Stabilitätspakts zu erreichen, die nur über hastiges Kürzen an Investitionen zu erreichen waren. Nach Schätzung des Kieler Instituts ist der Kapitalstock öffentlicher Einrichtungen seit 2003 – dem Jahr von Schröders Agenda-Rede – Jahr für Jahr drastisch geschrumpft. Überall fehlt Personal. Plötzlich gibt es nach Jahren steter Personalkürzungen Phänomene wie das Fehlen von Personal an Mainzer Bahnhöfen – etwas, was man vorher eher unterentwickelten Ländern zugeschrieben hätte.
Als Kehrseite des Sparbrötchen-Aufschwungs lässt ich auch einstufen, dass selbst nach einigen Jahren (mehr oder weniger) Wachstum und gesunkener Arbeitslosigkeit kein richtiger Boom der inländischen Nachfrage aufkommen will – anders als es Profioptimisten und Agenda-Freunde immer wieder vorhersagen. Dieses wie vergangenes Jahr stiegen die realen Konsumausgaben der Deutschen um jeweils nicht einmal ein Prozent. So etwas würde sich in den USA Krise nennen. Die Ausrüstungsinvestitionen schrumpfen, siehe oben, wie zwischenzeitlich selbst die Bauinvestitionen. Was ist das denn für ein Binnenboom?
Klar: wer so einseitig darauf setzt, die Bezahlung und Jobsicherheit von Beschäftigten zugunsten von Flexibilität und Kostenvorteilen für die (Export-)Wirtschaft zu beschränken, darf sich nicht wundern, wenn die Beschäftigten zwar Jobs haben, die aber nun oft so wacklig sind, dass der Mut schwindet, Geld für größere Anschaffungen auszugeben oder wieder mehr Kinder in die Welt zu setzen – und Unternehmen daher auch nicht mehr so schnell in langfristig neue Kapazitäten investieren. Fatal.
Genau hier beginnt eine weitere Gefahrenzone für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands. Weil es, anders als versprochen, bislang nicht gelungen ist, dem Exportaufschwung einen entsprechenden Binnenaufschwung folgen zu lassen (wie das manches deutsche Lehrbuch als typisch deutsch beschreibt), ist bislang auch nichts daraus geworden, das gefährlich enorme Hinterherhinken der Importe gegenüber den Exporten zu beheben. Im Gegenteil: nach Prognose des Kieler Instituts wird der deutsche Leistungsbilanzüberschuss 2014 sogar wieder auf die Rekordhöhe von 175,2 Mrd. Euro steigen. Alarm: So etwas kann makroökonomisch auf Dauer nicht gut gehen. Wenn auch nur ein bisschen dran ist an der international gängigen These, dass die hohen globalen Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen ein wichtiger tieferer Grund für den großen Crash 2007 und die Euro-Krise seit 2009 waren, dann sind die erneut steigenden Überschüsse ein atemberaubend böses Omen.
Da hilft auch der ewige deutsche Konter wenig, dass dieser Überschuss halt das Problem der anderen (also der Defizitländer) ist, weil die (angeblich nur) nicht wettbewerbsfähig sind. Das ist erstens nicht richtig, da Deutschland auch mit hoch wettbewerbsfähigen Ländern Überschüsse hat. Und zweitens hilft es ja auch wenig, sich moralisch als besser zu erklären – wenn das im Ergebnis (trotzdem) in eine neue Krise führt, die uns womöglich viel schlimmer treffen würde als die letzte. Mittlerweile haben die europäischen Südländer ihre Defizite im Handel mit Deutschland ja auch abgebaut, dafür liegen jetzt Amerikaner, Franzosen und sogar die (billigen) asiatischen Schwellenländer im Minus. Das liegt eben nicht nur an der Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch an der strukturell-pathologischen Schwäche der deutschen Importnachfrage.
Es hat etwas Groteskes, sich über solche Exportbilanzen zu freuen. Mit jedem Jahr, in dem Deutschland einen dreistelligen Überschuss von Exporten gegenüber Importen einfährt, muss es rein logisch irgendwo auf der Welt Länder geben, die per Saldo zusammen dreistellige Milliarden-Defizite haben, also: die Schulden in dreistelliger Milliardenhöhe gegenüber den Deutschen aufhäufen. Und es steigt die Gefahr, dass deutsche Banken mit diesen Überschüssen wieder irgendwo auf der Welt investieren, wo sich das lukrative Investment im Nachhinein als Blase herausstellt. Das kann auf Dauer nicht gut gehen, wie sich beim Crash ab 2007 gezeigt hat, als Deutschland schon einmal so hohe Überschüsse hatte wie jetzt wieder – und die Banken am Ende mit dreistelligen Milliarden gerettet werden mussten (obwohl Deutschland doch angeblich so solide dastand), weil sie das schöne Geld wie alle in US-Subprime oder spanische Immobilien gesteckt hatten.
Es ist gruselig, wie wenig davon hierzulande die Rede ist. Zumal in einem Wahlkampf, in dem es ja eigentlich um die Vermeidung künftiger Probleme und Krisen gehen sollte. In Brüssel hat Angela Merkel dafür gesorgt, dass selbst derart untragbare Überschüsse keine Rüge nach sich ziehen, anders als das ursprünglich geplant war und makroökonomisch vernünftig wäre. Fatal. Dabei wäre das im Grunde in unserem eigenen Interesse.
Ein Aufschwung, der von derart gefährlichen Umständen begleitet wird, kann nicht wirklich ein dauerhaft solider Aufschwung sein. Natürlich wäre es genauso absurd, dies jetzt durch Exportverluste beheben zu wollen, was auch niemand ernsthaft fordert. Um die Überschüsse abzubauen, bräuchte es schlicht und einfach über eine ganze Reihe Jahre deutlich schneller wachsende Importe als Exporte. Das wird sich automatisch kaum einstellen, soweit lässt sich die Bilanz der vergangenen Jahre kurz vor Wahltag lesen.
Dafür bräuchte es einer ganz neuen wirtschaftspolitischen Linie – einer schlauen Strategie, die Binnenkräfte weckt, ohne die Exportkräfte zu schädigen. Und eine Abkehr von der tief sitzenden Sparbrötchen-Logik, wonach wirtschaftlicher Fortschritt angeblich durch Verzicht und Kürzungen entsteht – so wie es die deutsche Kanzlerin auf fatale Weise jetzt den Krisenländern in Europa auferlegt hat, statt aus der eigenen Erfahrung der vergangenen Jahre die wahrscheinlich besseren Schlüsse zu ziehen. Das geht nur über ganz größe Schübe an Investitionen in Straßen, Brücken, Kanalisationen, Forschung, Bildung, Klimaschutz, all sowas. Auch wenn das erstmal teuer ist. Dann würde die Binnenwirtschaft expandieren – und die (Export-)Wirtschaft mehr noch durch Innovationen getrieben, ebenso wie durch neu erstarkte Handelspartner im ehedem kriselnden Ausland. Und dann käme das Geld auch wieder rein. Auf Dauer stünde Deutschland so mit Sicherheit viel solider da als jetzt in diesem irgendwie geliehenen Aufschwung.
So. Dann wählt mal schön.
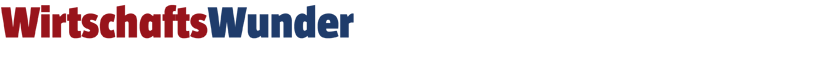





Jaja, die Leistungsbilanzüberschüsse… PR-technisch ein Meisterwerk, hat man daraus doch den Exportweltmeister gemacht. Dass es einen gravierenden Unterschied zwischen Export und Exportüberschuss gibt, geht daran völlig unter. Richtiger wäre zu sagen, Deutschland ist Exportüberschussweltmeister, was den Kritikern sofort die Möglichkeit gebe, dass Deutschland eben auch (logischer Weise) Importdefizitweltmeiser ist, was schon sehr viel weniger als ein Grund zur Freude klingt. Das wurde geschickt verhindert und nun haben wir eine vor Plattheit und logischer Unvernunft strotzende Scheindebatte über einen Sachverhalt, der ganz Europa zu sprengen droht. Man muss sich anhören, wie man gegen Exporte sein kann, dabei ist das überhaupt nicht das Thema. Niemand kann etwas gegen Exporte haben, aber gegen dauerhafte Exportüberschüsse muss man etwas haben, zumal in einer Währungsunion, wo die zwingend vorhandenen Exportdefizitländer keine Chance haben, sich dagegen zu wehren, weil es das Mittel der Abwertung nicht mehr gibt. Ohne diese Währungsunion wäre der ökonomisch vollkommen irrsinnige Weg, den Deutschland ab 2002 ging, gar nicht erst möglich gewesen.
Was mich an dieser Debatte ganz besonders ärgert, ist, dass das alles wirklich pippieinfach zu begreifen ist. Man muss dazu wirklich nicht Ökonomie studiert haben, sondern sich einfach mal die Frage stellen, wohin denn diese ganzen Warenüberschüsse eigentlich gehen und wie wir dafür jemals einen Warengegenwert zurückbekommen sollen, wenn wir weiterhin ständig Überschüsse erwirtschaften wollen? Ach ja, als Gegenwert bekommen wir dann ja Geld von den Defizitländern… Und was ist der Gegenwert von Geld? Doch nicht etwa Waren? Ja, da beißt die Katze sich in den berüchtigten Schwanz. Aber wen interessiert denn schon schlichte Logik, wenn man den Gegnern dieser „Wirtschaftspolitik“ mit Planwirtschaft kontern kann, ohne dafür schallend ausgelacht zu werden. Brüderle lässt grüßen…
Investitionen in „ganz große Schübe“ sind Politikern meitens fremd, denn Investitionen wirken leider nur langfristig. Schöne Beispiele wären doch Schübe in Bildung und Forschung, Renten, Energie und Klimaschutz usw., aber da sieht es eher „mau“ aus und die Lehren z. B. aus der Wahl nach Fukushima scheinen vergessen (ich meine das nicht politisch). Langfristig wirken dann „wenigstens“ die Folgen fehlender Investitionen. http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/akw-fukushima-wasserdrama-soll-noch-ein-jahrzehnt-dauern-a-921025.html
> „Das geht nur über ganz größe Schübe an Investitionen in Straßen, Brücken, Kanalisationen, Forschung, Bildung, Klimaschutz, all sowas.“
Ganz große Schübe wären sehr schön und wohl auch zu finanzieren, wenn Steuererhöhungen jene treffen würde, die gegenwärtig mit den Exportüberschüssen das dazu passende Kapital exportieren.
Ein zusätzlicher Weg besteht darin, den privaten Konsum durch Stärkung der unteren Einkommen (Mindestlohn) anzukurbeln.
Ich weiß wohl, wen ich wählen werde, auch wenn ich zugeben muss, dass diese (die ich wählen werde) es gerne in so kompakter und schöner Form wie in diesem Artikel hätten im Wahlkampf darstellen können.