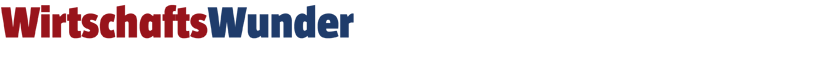Die Kolumne – Bedingt abschwungbereit
Deutschland hätte eigentlich ganz gute Karten, um den gefährlichen konjunkturellen Abschwung dieser Wochen einigermaßen glimpflich zu überstehen. In Wirklichkeit droht genau das Gegenteil.
Noch vor wenigen Wochen hat Peer Steinbrück verboten, von Rezession zu reden. Umsonst. Jetzt scheint klar, dass die deutsche Wirtschaft einen Abschwung erlebt. Und die Frage ist eher, ob die Zeit noch reicht, um zu verhindern, dass daraus eine gefährliche Abwärtsspirale wird. Und eine Dauerflaute wie nach 2001, als Finanzminister und Kanzler ebenso lange noch Durchhalte- und Ruhige-Hand-Parolen ausgaben.
Auf den ersten Blick wirken die Bedingungen heute deutlich besser, um Schlimmeres zu verhindern. Die Deutschen könnten im Grunde glimpflicher als andere davonkommen. Dagegen spricht, dass Deutschlands Politprofis, Notenbanker und Gewerkschafter womöglich wenig aus der Rezessionserfahrung von damals mitgenommen haben – und ähnlich zweifelhaft auf konjunkturelle Krisensignale reagieren.
Hoffnung auf billiges Öl
Zu den allgemeinen Hoffnungswerten zählt, dass Ölpreis und Euro seit Wochen stark fallen. Zu den deutschen zählt auch, dass es Reformen am Arbeitsmarkt gab. Diese Reformen könnten jetzt dazu führen, dass die Unternehmen nicht mehr so schnell entlassen.
Anders als in den USA, Großbritannien und Spanien gab es hierzulande auch keine Immobilienblase, die jetzt gerade platzt. Und: Die Bilanzen der deutschen Firmen seien solider als 2001, schreiben die Konjunkturforscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft in ihrer neuen Prognose. Anders als bei Amerikanern und Briten sei in Deutschland selbst die Verschuldung der Privathaushalte seit 2001 gesunken.
All das klingt auf Anhieb gut. Ob es sehr viel hilft, ist zweifelhaft. Wenn Deutschlands Verbraucher Schulden abgebaut haben, ist das auch Ausdruck tief sitzender Zukunftsangst – kein Ambiente für krisenresistente Ausgabenfreude. Ähnliches gilt für die deutsche Baubranche, die auf niedrigem Niveau nicht weiter abstürzt. Toll. Und wenn der Ölpreis fällt, ist das zuerst auch ein Indiz dafür, wie bedenklich derzeit weltweit die Nachfragedynamik nachlässt.
Als deutsche Hoffnungswerte taugen billigere Öl- und Euro-Kurse nur bedingt. Gerade weil der Euro zum Dollar stark fällt, sinkt der Ölpreis in hiesiger Währung viel langsamer: seit Juli um 17 Prozent, statt um ein Drittel in Dollar-Rechnung. Und der Wechselkurseffekt wird wiederum relativiert, weil der Euro nur zum Dollar stürzt, weniger gegenüber anderen. Im Schnitt ist der Außenwert seit Juli nur um fünf Prozent gesunken – statt um 13 Prozent, wie gegenüber der US-Währung. Verglichen mit Anfang 2006 sind Waren aus Euroland damit im Schnitt immer noch zehn Prozent teurer.
Was an tatsächlicher Entlastung übrig bleibt, wirkt auf die Konjunktur aller Erfahrung nach erst mit ein paar Quartalen Verspätung. Dann droht der Abschwung bereits Eigendynamik gewonnen zu haben.
Fraglich ist, ob sich die neue Flexibilität am Arbeitsmarkt dann als Rettung erweist. Zeitarbeiter lassen sich flexibler einstellen – aber genauso flexibel wieder kündigen, wenn es konjunkturell schlecht läuft. Ähnliches gilt in Sachen Hartz IV: Der erhöhte Druck, Jobs anzunehmen, wirkt, wenn Firmen händeringend Kräfte suchen – nicht, wenn Personalpläne wie derzeit nach unten korrigiert werden.
Nach Diagnose der Kieler Forscher wurden im Boom vor allem deshalb mehr Stellen geschaffen als bei ähnlichem Wachstum üblich, weil die Löhne so langsam zulegten. So etwas ist auf Dauer gar nicht durchzuhalten. Im Aufschwung lässt der Markt irgendwann die Löhne steigen, das ist halt so.
Als Handicap könnten sich jetzt sogar die manischen Anstrengungen der Wirtschaftspolitik erweisen, kostengünstiger gegenüber dem Rest der Welt zu werden. Mittlerweile hängt die deutsche Wirtschaftsleistung zu fast der Hälfte vom entsprechend aufgepumpten Export ab: also davon, ob es dem Rest der Welt gut geht – oder schlecht, wie jetzt der Fall. Nach Rechnung des Kieler Instituts ist kaum ein anderes Land so sehr auf den Absatz in Länder angewiesen, in denen Immobilienmärkte gerade kriseln. Der deutsche Export werde „eine lange Durststrecke erleben“, prophezeien die Forscher.
Wobei Italiener, Franzosen und Spanier derzeit auch deshalb kriseln, weil die Deutschen ihre Kosten so erfolgreich gekürzt haben. Jetzt wundern sich deutsche Exporteure, dass die Nachfrage dort plötzlich stark nachlässt.
Neuauflage finanzpolitischer Chaostage
All das reicht womöglich, um den ein oder anderen deutschen Hoffnungswert zu kompensieren. Die Erfahrung des vorigen Abschwungs lässt befürchten, dass es sogar schlimmer kommt. Auch damals, 2002, gab es einen Finanzminister, der mit dem Ziel eines durch nichts infrage zu stellenden Nulldefizits (damals für 2006) in die Wahlen ging. Auch damals gab es eine Notenbank, die noch mitten im Abschwung beteuerte, dass sie ihre Zinsen nicht so stark senken müsse wie die US-Fed. Und auch damals gab es Metallergewerkschaften, die Nachschläge von (fast) sieben Prozent für den verblichenen Aufschwung forderten.
Was damals folgte, waren finanzpolitische Chaostage, als die Steuereinnahmen plötzlich konjunkturbedingt ausblieben, der Finanzminister zum Ausgleich Steuerreformen verschob und alle möglichen Beiträge anhob, um bloß nicht vom Nulldefizitziel abrücken zu müssen. Verspätet sinkende Zinsen und überhöhte Lohnabschlüsse taten ein Übriges. Deutschland erlebte eine Entlassungswelle, und die Krise dauerte länger als bei allen anderen.
Das muss nicht wieder so kommen. Könnte aber. Wenn bald die Einnahmen konjunkturbedingt ausbleiben, droht wie 2002 im Wahljahr die nächste Welle hektischer Kürzungen, höherer Abgaben und Steuern. Weil Deutschland neben verspäteten Metallern und verirrten Notenbankern auch wieder einen Finanzminister und viele Haushaltspolitiker hat, deren Ein und Alles es ist, einem Nulldefizitziel konjunkturblind hinterherzulaufen – auch wenn sie damit am Ende alles nur noch schlimmer machen.
Mail: fricke.thomas@ftd.de