David Milleker: Renaissance der Fiskalpolitik?
Jüngst mehren sich die Anzeichen, dass die Fiskalpolitik (endlich) stärker in den Vordergrund rückt. Am deutlichsten durch die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten. Aber auch durch die jüngsten Äußerungen der EU-Kommission, die sich im November für eine stärkere Wachstumsunterstützung aus dieser Richtung ausgesprochen hat („Towards a positive fiscal stance for the euro area“, 16. November 2016).
In der praktischen Politik kommt damit etwas an, was in der akademischen Diskussion schon seit geraumer Zeit heiß diskutiert wird: Geldpolitik taugt nicht als alleiniges Mittel der Konjunkturpolitik. Bei unterausgelasteten Kapazitäten kann der Zins noch so niedrig sein, die Pferde saufen dann nicht. Hält diese Situation länger an, erodiert auch das Produktionspotenzial. Etwa dadurch, dass neue Technologien viel langsamer adaptiert werden oder die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Langzeitarbeitslosen erodieren.
Zunächst einmal ist daher die Bereitschaft ausdrücklich zu begrüßen, hier neue Wege zu gehen und die Geldpolitik aus ihrer Überforderung zu befreien. Zwei grundsätzliche Wermutstropfen gibt es dabei freilich:
Erstens kommt dieses Umdenken eigentlich zu spät. Das ist kein Argument gegen den Einsatz der Fiskalpolitik per se. Die recht umfangreiche Literatur der letzten Jahre zum „Fiskalmultiplikator“ – damit wird ausgedrückt, wieviel zusätzliche Wirtschaftsleistung für eine Geldeinheit Fiskalpolitik zustande kommt – zeigt, dass dieser umso größer ausfällt, wenn man sich in einer Rezession oder Kreditklemme befindet. Heute gilt auf beiden Seiten des Atlantiks weder das eine noch das andere – soviel kann man der Geldpolitik der letzten Jahre zugute halten.
Zweitens ist die Struktur der Maßnahmen ebenfalls hoch relevant: Direkte Staatsausgaben wirken am stärksten. Steuersenkungen umso stärker, je mehr sie am unteren Ende der Einkommensverteilung ansetzen. Ertragssteuersenkungen für Unternehmen haben den geringsten Konjunktureffekt.
Zugegebenermaßen ist ein Präsident Donald Trump hier immer noch ein unbeschriebenes Blatt, so dass man erst einmal auf reine Annahmen angewiesen ist. Das Wahlprogramm der Republikaner sieht deutliche Steuersenkungen vor allem für Personen vor, die 100.000 US-Dollar und mehr Jahreseinkommen aufweisen. Der erwartete Konjunktureffekt daraus ist gering. Der „Infrastrukturplan“ ist wie vieles an der Programmatik des neuen US-Präsidenten reich an großen Zahlen und sehr schwach in den Details.
Offensichtlich will er nicht den geraden Weg wählen, die angestrebten Investitionen direkt über den Staatshaushalt zu finanzieren. Vielmehr werden Steuererleichterungen für Privatinvestoren in Aussicht gestellt. Hier kann man nun vieles hineininterpretieren. Vorstellbar ist quasi ein Schattenhaushalt: Private Investoren treten in Vorleistung, der Staat garantiert dann über lange Zeiträume „Mietzahlungen“. Nach aller Erfahrung ist das für den Privatinvestor wegen der Planungssicherheit attraktiv, für den Staat allerdings sehr teuer. Nur schlagen Ausbau/Modernisierung nicht sofort im Budget auf, sondern zeitlich gestreckt.
Eine andere Variante wäre eine wirklich private Infrastruktur – privat finanziert, mit Nutzungsgebühren als Ertragsquelle und vollem unternehmerischen Risiko für den Betreiber. In der Regel kommen hier keine wirklich hohen Investitionsvolumina zustande. Bestenfalls für die Sahnestückchen mit relativ sicherer Kalkulationsgrundlage.
Die stärkere Hinwendung zur Fiskalpolitik in den nächsten Jahren ist grundsätzlich zu begrüßen. Weder die Rahmenbedingungen noch die konkrete Ausgestaltung durch die republikanische Alleinregierung deuten allerdings darauf hin, dass sie am Ende tatsächlich den Erfolg bringt, den sie hätte haben können.
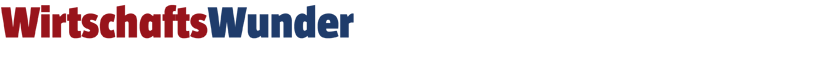





Ersetzen Sie Trump durch Merkel/Schäuble und Sie haben die Marschroute für Deutschland.
Guss,
Jens