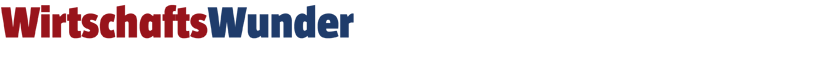Wenn es bei uns im Land um wirtschaftliche Vernunft geht, ist die Sache im Grunde einfach. Da gibt es Böse. Das sind, sagen wir, die Griechen. Und dann gibt es die Guten, die mit Geld umzugehen wissen, immer solide haushalten, eigentlich nie Schulden machen. Das sind wir. Und wir. Und wir. Und der Niederländer. Und der Brite. Zumindest wurde das diese Woche ja gelegentlich wieder bedauernd angemerkt, wo der Brite uns jetzt verlässt – und wir in der Europäischen Union zu Minderheitsguten zu werden drohen.
Natürlich Blödsinn. Wenn die Briten spätestens seit Ausbruch der Finanzkrise eins nicht mehr sind, dann: unerschütterliche paläo-stabilitäts-liberale Glaubenskämpfer. Dafür sind die erstens zu pragmatisch, anders als so mancher Gralshüter bei uns. Zweitens zu geschockt davon, was drei Jahrzehnte Rumtata-Globaliberalisierung mit der britischen (Ex-)Industrie, der Finanzstabilität und dem Zusammenhalt im eigenen Land gemacht haben.
Genau darin könnte auch eine Chance liegen. Gut möglich, dass es in Großbritannien ungeachtet aller Brexit-Wirren heute mehr Experten und Politverantwortliche gibt als bei uns, die sich schon sehr viel mehr und radikaler darüber Gedanken machen, wie sich Reichtumsgefälle und Finanzdesaster vermeiden lassen. Was hier und da auch schon zu viel rabiateren politischen Eingriffen geführt hat, die so gar nicht zur alten Marktromantik passen. Hier könnte sogar die eine oder andere unorthodoxe britische Vorlage für das stecken, was Martin Schulz für sein noch etwas ausbaufähiges Wirtschaftsprogramm brauchen könnte.
German Klischee von den Stabilitätsbriten
Dass die Briten einfach nur markthörig sind, wirkt bei näherem Hinsehen ohnehin längst reichlich absurd. Die britische Notenbank hat gleich nach Ausbruch der großen Krise 2008 die Finanzmärkte mit Geld geflutet und massiv Staatsanleihen gekauft – wofür EZB-Chef Mario Draghi, der damit im Euroraum viel zu spät anfing, bei uns als Italiener beschimpft wurde. German Chauvinomics.
Nicht richtig zum German Klischee von den Stabilitätsbriten passt auch das britische Gebaren im Staatshaushalt. In der Krise gab es Rekorddefizite. Nimmt man übliche konjunkturelle Schwankungen heraus, lagen die öffentlichen Ausgaben 2016 inselweit immer noch um 2,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts höher als die Einnahmen – gegenüber nur 2,1 Prozent in Frankreich und 0,4 Prozent in Italien. Schludern aus Überzeugung: Die Briten haben dem EU-Fiskalpakt deutscher Prägung nie zugestimmt. So viel zur europäischen Stabilitätsgenetik.
Ob das jetzt gut war oder nicht – zumindest als Stabilitätsvorbild nach orthodox deutscher Vorstellung taugen die Briten nach alldem kaum. Ganz im Gegenteil. Zu Vordenkern könnten sie jenseits aller akuten Brexit-Turbulenzen eher deshalb werden, weil es auf der Insel weit mehr Denker und Praktiker gibt, die ziemlich radikale Lehren aus der Krise ziehen.
Not macht erfinderisch. In kaum einem Land haben die Kehrseiten der rumpel-liberalen Globalisierung so viele Schäden angerichtet wie im einstigen Wirkungsbereich der diesbezüglich ikonischen Margaret Thatcher. Von der britischen Industrie ist im freien Wettbewerb und vor lauter Vergötterung des Finanzgewerbes nur wenig übrig – vor allem verwüstete Regionen, in denen die Leute vergangenes Jahr für den Brexit stimmten.
- Der Industrieanteil hat sich seit 1990 auf weniger als zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts nahezu halbiert.
- An den weltweiten Exporten haben die Briten nur noch einen Anteil von knapp vier Prozent.
- Kaum anderswo ist das Einkommen in der Zeit der Finanzglobalisierung so dramatisch auseinandergedriftet.
- Das obere Fünftel der Briten hat heute mehr als siebenmal so hohe Einkommen wie das untere. Unter den reicheren Ländern ist nur in den USA, Singapur und Portugal das Gefälle noch größer.
- Und nach Studien hat das Auseinanderdriften enorme gesundheitlich-soziale Probleme mit sich gebracht: mehr Fettleibige, Kranke, Teenagergeburten.
All das erklärt, warum auf der Insel schon seit Jahren sehr viel aktiver als anderswo nach Gegenmitteln gesucht wird. Warum dort 2012 in London eines der konsequentesten Gesetze zur Vermeidung weiterer Finanzkrisen verabschiedet wurde – nach dem die Währungshüter den Banken notfalls ziemlich illiberal Vorschriften machen dürfen. Und dass die Bank of England einen ziemlich radikalen Chefökonomen beschäftigt, der ein „staatliches Einschreiten gegen das wirtschaftlich kostspielige Kurzfristdenken in den Konzernen“ fordert – bei der Bundesbank schwer vorstellbar.
Die bitteren Erfahrungen dürften auch erklären, warum auf der Insel gut eineinhalb Jahrzehnte früher als in Deutschland ein Mindestlohn eingeführt wurde. Warum es seitdem eine Niedriglohnkommission gibt, die in Deutschland als Vorbild gilt. Und warum es britische Forscher waren, die 2009 jenes Werk über die gesundheitlich-sozialen Folgen von Ungleichheit herausbrachten, nach dem es auch wirtschaftlich lohnt, das Gefälle abzubauen – wogegen Sachverständige in Deutschland anno 2017 noch darüber sinnieren, ob es überhaupt mehr Ungleichheit auf der Welt gibt.
Seit Kurzem gibt es zudem eine „Kommission für wirtschaftliche Gerechtigkeit“, in der neben Wissenschaftlern und Investmentbankern der Siemens-Boss UK und der Erzbischof von Canterbury nach „neuen Fundamenten für unsere Wirtschaft“ suchen.
Was die Briten zur Wirtschaft sagen, kommt in Deutschland gut an
All das heißt noch nicht, dass der Brite auch richtig gute Antworten auf alles findet. Zumal es jetzt auch gilt, den Brexit irgendwie hinzubekommen. Und natürlich ist auch nicht alles vergleichbar. Nur ist bei uns auch nicht alles anders.
Bei den Einkommen, die durch Arbeit entstehen, ist das Gefälle zwischen Reich und Arm mittlerweile ähnlich dramatisch – was allerdings bei uns ein ziemlich teurer Sozialstaat teils ausgleicht. Ähnliches gilt für die Vermögensverhältnisse. Und für das Risiko, von Finanzschocks und (Immobilien-)Blasen ereilt zu werden. Spätestens in der nächsten Krise werden auch wir sehr viel mehr unorthodoxe Antworten auf die Kehrseiten der Globalisierung brauchen – zumal schon jetzt, in relativ guten Zeiten, so viel Unmut schwelt, dass Herr Schulz zum Shootingstar wurde.
Das Schöne an der Idee, sich von den britischen Lehren aus der Krise inspirieren zu lassen, ist: Was die Briten zur Wirtschaft sagen, kommt in Deutschland immer gut an. (Anders als, sagen wir, wenn dasselbe jetzt einer vom Stamme der Griechen oder Italiener sagt.) Gut für uns.
Umgekehrt könnte das auch für jene Briten eine feine Sache werden, denen gerade gelegentlich Zweifel daran kommen, ob ihr Land noch etwas Sinnvolleres für die Welt hinbekommt, als etliche Leute in den nächsten zwei Jahren damit zu beschäftigen, ein Brexit-Monstrum zu verhandeln, das viele Leute von der Arbeit abhält, alle ärgert – und die Briten am meisten kosten wird.