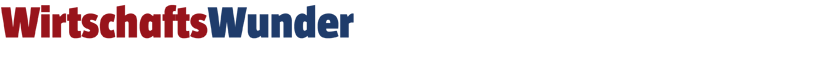Millionen Arbeitslose, immense Staatsschulden, seit Jahren kaum noch Wirtschaftswachstum – und ein Volk, das es satt hat, weiter sparen zu müssen. Frankreich 2017? Oder Deutschland im Herbst 2005, als die Wirtschaft über Jahre stagniert hatte, die Arbeitslosigkeit bei fast fünf Millionen lag – und der Befund unserer Großökonomen noch lautete: Das Land ist einfach nicht reformierbar – und die Agenda 2010 bestenfalls ein „Trippelschritt“ (Angela Merkel anno 2003) in die richtige Richtung.
So klang das damals noch. Bevor die deutsche Wirtschaft Anfang 2006 urplötzlich (und weitgehend unvorhergesehen) zu wachsen und die Arbeitslosigkeit zu sinken begann – und der Aufschwung in Erklärungsnot zum Ergebnis der unerhört großartigen Reformen umgedeutet wurde und wir schmuddelige Rote-Laterne-Halter zu Vorbildern zwangsromantisiert wurden. Hier wird die Sache spannend. Denn in Frankreich könnte sich bald Ähnliches tun.
Kurios, aber wahr: Während im aktuellen Wahlkampf neben Terrorsorgen gallische Untergangsstimmung herrscht, mehren sich seit Wochen positive Signale aus der Wirtschaft. Nach Umfragen unter Einkaufsmanagern sind die Geschäftsaussichten so gut wie seit Sommer 2011 nicht mehr – vor allem bei Dienstleistern. Sogar besser als bei uns. Die Pariser Hotelbranche meldete für Januar den besten Monat seit zehn Jahren – trotz der Terrorangst. Auch Projekte ausländischer Investoren gab es seit zehn Jahren nicht mehr so viele wie 2016. Und aus keinem Land kamen dabei so viele Geldgeber wie aus Deutschland. Nirgendwo anders in Europa sind deutsche Investoren derzeit so aktiv.
Frankreichs Export lag Ende 2016 immerhin 18 Prozent höher als vor der Krise 2008. Die Unternehmen investierten vier Prozent mehr als noch im Frühjahr 2015. Und die Kapazitäten der Industrie sind zumindest wieder so ausgelastet wie 2008. Das ist noch kein Boom. Aber auch kein Zeichen ewigen Siechtums – oder etatistischer Erstarrung, wie es das Klischee für Frankreich hierzulande vorschreibt.

Es gehört zu den typischen Mustern nach langer Stagnation, dass Aufschwünge just dann einsetzen, wenn keiner sie mehr erwartet (siehe oben), und es dauert, bis sie beim Volk ankommen. In Deutschland erleben wir gerade, dass so ein Aufschwung bei falscher Handhabung selbst nach zehn Jahren noch an vielen vorbeigehen kann. In Frankreich gab es zum Jahreswechsel per Saldo immerhin schon 200.000 Arbeitsplätze mehr als ein Jahr zuvor: der stärkste Anstieg seit fast zehn Jahren. Laut einer Umfrage planen die Firmen, 2017 zwei Millionen Leute einzustellen – der stärkste Anstieg seit 2002.
Wie kann das sein? Wo die doch keinen Gérard und keine „Agenda“ hatten?
- Erstens haben wir in Deutschland eben auch nicht so radikale Reformen gehabt, dafür aber ein besseres Marketing („Agenda 2010“ klang halt toll) – was dagegen spricht, dass hier das Wunder lag. Laut OECD-Auswertung sind normale Arbeitsverträge bei uns sogar noch etwas stärker geschützt (für orthodoxere Ökonomen: unflexibler) als in Frankreich.
- Zweitens haben die Franzosen mehr saniert, als es hiesige Beobachter gern nachplappern – die strukturellen Staatsdefizite sind in sechs Jahren um 3,6 Prozent der Wirtschaftsleistung gesenkt worden, stärker als einst bei Schröder.
- Drittens kommt so ein Aufschwung aus guten Gründen oft dann, wenn es keiner mehr erwartet – Selbstheilungskräfte.
„Hohe Symbolkraft“ könnte das haben, was Frankreichs Autoindustrie durchmacht, meint Xavier Timbeau vom Pariser Forschungsinstitut OFCE. In der Krise habe mindestens ein Anbieter vor dem Aus gestanden, musste vom Staat gestützt werden, auch weil es rundherum kriselte – und Italiener wie Spanier weniger Autos kauften. Mittlerweile haben sich die Konzerne derart saniert, dass sie schwächelnde deutsche Marken wie Opel übernehmen – und wieder Leute einstellen.
Selbst in Italien bessert sich die Stimmung
In Spanien, wo seit jeher mehr Menschen französische Autos fahren als bei uns, zieht die Nachfrage an. Selbst in Italien bessert sich die Stimmung. Mancher französische Autohersteller klagt schon wieder über Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden. Kommt uns bekannt vor.
Gerade weil die Arbeitslosigkeit über Jahre so hoch war, sind die Löhne (und Kosten) in Frankreich seit 2011 deutlich langsamer gestiegen als in Deutschland – um insgesamt fast zehn Prozentpunkte langsamer. Von wegen starre Löhne. Dazu kommt, dass der Euro fast 20 Prozent abgewertet hat, was ebenfalls hilft, die (exportorientierten) Unternehmen zu sanieren. Ebenso wie die niedrigen Zinsen. Und ein Hilfsprogramm der Regierung. Frankreichs Industrie habe in den vergangenen drei Jahren ihre Gewinnmargen so spektakulär verbessert wie nie, sagt OFCE-Konjunkturchef Eric Heyer.

Auch das ist keine Garantie für schwindende Arbeitslosigkeit. Nur hätte das auch kaum ein Großexperte im Herbst 2005 von Deutschland gesagt – als sich die positiven Signale mehrten und die neue Regierung unter Angela Merkel bei immer noch mehr als drei Prozent Staatsdefizit den Reformstoppknopf drückte. Das dürfte den Unternehmen sogar geholfen haben, wieder planen zu können. Und dann wirken nach langen Krisen ohnehin sich selbst verstärkende Mechanismen: Da werden Investitionen nachgeholt, die in der Krise zurückgehalten wurden; und die immer älter gewordenen Autos gegen neue ausgetauscht.
Ein Aufschwung ohne großes Agenda-Gedöns
Auch das garantiert noch nicht den großen Franko-Aufschwung. Die Deutschen hatten 2005/06 Glück, dass die ganze Welt just zu dieser Zeit wie irre boomte, der Welthandel um acht bis neun Prozent expandierte und Schwellenländer wie China deutsche Maschinen brauchten. Was bedeutete, dass überall die Lohnkosten kräftig zulegten – nur bei uns nicht. Schön für Germany.
Heute wächst der Welthandel nur um drei Prozent pro Jahr, und die Löhne steigen fast überall eher moderat. Dazu kommt die Terrorgefahr. Und fraglich ist, ob Frankreichs neuen Regierenden von der EU in Brüssel dasselbe zugestanden wird wie Merkel Ende 2005: die Staatsdefizite nicht weiter herunterprügeln zu müssen – und die Konjunktur Fahrt aufnehmen zu lassen. Da braucht unser Finanzminister zur Einsicht wahrscheinlich einen Zaubertrank.
Wäre halt schön, wenn wir jetzt ansatzweise so viel bei den anderen kauften, wie die anderen es bei uns getan haben, als wir noch als Nullen galten. Dann könnten die Franzosen versuchen, einen Aufschwung hinzubekommen, der mehr Leute mitzieht, als das bei uns bisher der Fall war – ohne großes Agenda-Gedöns.
Bleibt die Frage, ob all das obsolet ist, wenn Marine Le Pen die Wahl gewinnt und dann mit dem Euro-Austritt kommt. Die Erfahrung mit den ausbleibenden Abstürzen nach Brexit-Votum und Trump-Wahl lässt manchen vielleicht dazu neigen, das locker zu sehen. Es könnte allerdings sein, dass es bislang glimpflich blieb, weil es in beiden Fällen nicht um die Aufgabe der eigenen Währung ging. Und der Aufschwung schon fortgeschritten war. Also lieber nicht versuchen. Katastrophengefahr.