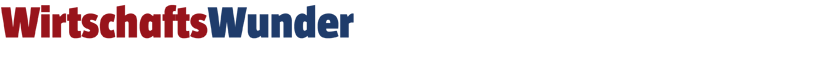David Milleker – Und jährlich grüßt der US-Haushaltsstreit
Die parlamentarische Sommerpause in den USA ist vorbei, und schon steht der Besuch eines alten Bekannten ins Haus: der alljährliche Streit um den US-Bundeshaushalt. In der neuen Episode geht es konkret um die Anhebung der Schuldenobergrenze. Das Gezerre zwischen Republikanern und Demokraten geht nun schon seit einigen Jahren so. In den zentralen Episoden sorgte 1995 der republikanisch dominierte Kongress für eine Schließung zahlreicher öffentlicher Einrichtungen. 2011 stand dies ebenfalls kurz bevor, in der damaligen Aufführung sogar mit dem Schreckgespenst eines Staatsbankrotts. Und zu Beginn dieses Jahres dann wieder mit der Fiskalklippe.
Und jährlich grüßt der US-Haushaltsstreit
Die parlamentarische Sommerpause in den USA ist vorbei, und schon steht der Besuch eines alten Bekannten ins Haus: der alljährliche Streit um den US-Bundeshaushalt. In der neuen Episode geht es konkret um die Anhebung der Schuldenobergrenze. Das Gezerre zwischen Republikanern und Demokraten geht nun schon seit einigen Jahren so. In den zentralen Episoden sorgte 1995 der republikanisch dominierte Kongress für eine Schließung zahlreicher öffentlicher Einrichtungen. 2011 stand dies ebenfalls kurz bevor, in der damaligen Aufführung sogar mit dem Schreckgespenst eines Staatsbankrotts. Und zu Beginn dieses Jahres dann wieder mit der Fiskalklippe.
Im Folgenden wollen wir kurz skizzieren, was zur Diskussion steht. Den Schwerpunkt bildet dann aber ein Erklärungsversuch, warum es der US-Politik so unheimlich schwer fällt, zu tragfähigen Lösungen in der Sache zu kommen.
Zunächst eine kurze Erläuterung, was es mit der Schuldenobergrenze auf sich hat. Der Kongress verabschiedet zwar jedes Jahr einen Haushalt mit (weitgehend) bekannten Implikationen für Defizit und Staatsverschuldung. Vollkommen losgelöst davon setzt er aber auch eine absolut fixierte Obergrenze für die Staatsverschuldung. Wird diese Obergrenze erreicht, darf die Bundesregierung formal gesehen nur noch das ausgeben, was sie laufend einnimmt. Das ginge allerdings nur bei faktischem Verstoß gegen andere verabschiedete Gesetze wie den laufenden Haushalt. Ökonomisch wie juristisch eigentlich eine verquere Situation.
Verständlich wird sie dann, wenn man die Schuldenobergrenze unter institutionellen Gesichtspunkten betrachtet: Sie kann eine Nachdenkpause bewirken, ob bei der Haushaltsentwicklung ein Umsteuern erforderlich ist oder nicht. Faktisch ist die Schuldenobergrenze allerdings zu einem politischen Hebel mutiert, bei dem das republikanisch dominierte Repräsentantenhaus versucht, Regierung und Senat (beide in demokratischer Hand) schlecht aussehen zu lassen, indem man ihre Handlungsunfähigkeit demonstriert. Im demokratischen Prozess ist dies zwar nun beileibe nicht ungewöhnlich, wie man das ja auch in Deutschland bei zustimmungspflichtigen Gesetzen des Bundesrates kennt. Erstaunlich ist allerdings die Intensität der US-Auseinandersetzungen in der jüngeren Vergangenheit.
Da in den USA die Abgeordneten durch ein reines Mehrheitswahlrecht bestimmt und ihr Stimmverhalten auch in jeder Einzelabstimmung dokumentiert wird, lässt sich die parteipolitische Polarisierung im Parlament sogar messen. Bis in die 1980er Jahre stimmten knapp 40% aller Abgeordneten noch regelmäßig entgegen der Linie der eigenen Partei ab. Inzwischen sind es im Repräsentantenhaus nur noch 5% und im Senat 15%. Anders ausgedrückt: Es gab einmal eine breite Strömung im Parlament, die lagerübergreifende Kompromisse möglich machte, die aber heute fast ausgestorben ist.
Wenn man ganz grob auf die Struktur des US-Haushalts und seine Entwicklung schaut, ist eigentlich relativ schnell klar, wo der Schuh strukturell drückt: Das Steueraufkommen ist zu niedrig (etwa 2 Prozentpunkte der Wirtschaftsleistung), das Verteidigungsbudget ist zu hoch (etwa 1,5 Prozentpunkte der Wirtschaftsleistung) und die Kostenexplosion im Gesundheitswesen (etwa 0,8 Prozentpunkte der Wirtschaftsleistung) hat die Sozialausgaben in die Höhe getrieben. All dies auf Basis von Trends, die nichts mit der Finanz- und Wirtschaftskrise zu tun haben, sondern etwa ab dem Jahr 2000 politisch eingeleitet wurden. Die USA hätten keinerlei nennenswerte Probleme im Bundeshaushalt, wenn es diese Trends nicht gegeben hätte.
Wenn es freilich so offensichtlich ist, wo der Schuh drückt, warum einigt man sich dann nicht auf einen Kompromiss? Zumal doch eigentlich alle Wahlen seit 2000 mehr oder minder mit einem Patt ausgegangen sind („50:50-Nation“). Zudem geben 40% aller Wähler an, keine Parteipräferenz zu haben, während sich 31% klar mit den Demokraten und 27% klar mit den Republikanern identifizieren. Rein theoretisch gibt es somit landesweit ein breites Wählerpotenzial „in der Mitte“.
Es gibt aber eigentlich keine nationalen Wahlen. Das gilt selbst für die Präsidentschaftswahlen, die ja über ein durch Wahlen auf Einzelstaatenebene ermitteltes Wahlmännergremium durchgeführt werden. Senatswahlen werden ebenso auf Einzelstaatenebene und das Repräsentantenhaus in Wahldistrikten durchgeführt. Schaut man sich die Stimmenverteilung regional an, so gibt es nur wenige Bundesstaaten, bei denen die Parteien relativ eng beieinanderliegen. In der großen Mehrheit der Bundesstaaten gilt dagegen, dass die Stimmenverteilung etwa 60:40 für die eine oder andere Partei liegt. Das heißt: Ist ein Bewerber erst einmal von seiner Partei nominiert, kann er sich seines Einzugs ins Parlament so gut wie sicher sein. Entscheidend ist also das parteiinterne Nominierungsrennen, nicht die anschließende Parlamentswahl. Entsprechend macht es für einen Bewerber viel mehr Sinn, sich an der eigenen Parteibasis als an einem hypothetischen Durchschnittsamerikaner zu orientieren. Im Klartext heißt das: Durch Kompromisse mit dem politischen Gegner lässt sich in den USA für einen Politiker kein Blumentopf gewinnen.
In Summe spricht auch diesmal leider nichts dafür, dass die neue Episode des Haushaltsstreits anders ausgeht als die bisherigen: Einigung in letzter Minute mit einem unbefriedigenden Ergebnis und garantierter Folgeepisode in sechs bis zwölf Monaten.