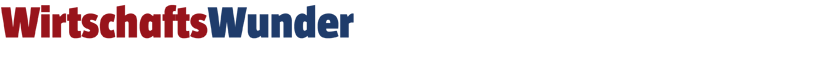Auf wen sollen wir jetzt sau(r)er sein: die Queen – oder Bono? Oder irgendwelche Minister und Konzerngrößen, die ihr Geld auch irgendwo hingeschickt haben, wo kein Finanzminister ist – und damit Gelder abziehen, mit denen wir sonst bei uns Schulen renovieren oder wichtige Forschungsexperimente bezahlen könnten?
Eher müßig. Wenn seit Jahren immer neue Sensationen bekannt werden, wie finanziell ganz gut ausgestattete Menschen ihr Geld verstecken, dann hat das nur zum Teil mit moralischen Untiefen oder schicksalhafter Globalisierung zu tun. Sowas gibt es halt, könnte man dann sagen.
Was uns da begegnet, ist so eine Art Frankensteinmonster, das uns kitschliberale Ökonomen vor ein paar Jahrzehnten gebastelt haben. Wobei die Verheißung lautete, dass bei möglichst fröhlich-freiem Wettbewerb um die niedrigsten Steuersätze zwischen den Nationen am Ende etwas ganz Tolles herauskommt: Wir alle zahlen weniger Steuern – und leisten dafür viel mehr.
Von wegen. Jetzt haben wir monströse Zustände.
Was da gerade so inbrünstig beklagt wird, ist einmal ziemlich willentlich eingeführt worden – zu Hochzeiten der liberal-globalen Ära, bei den Reagans und Thatchers. Und in der Theorie klang’s auch erstmal toll: Je freier und globaler Konzerne und Reiche wirtschaften können, desto mehr müssen Regierungen zusehen, dass ihnen die Leute nicht weglaufen, weil sie anderswo weniger Steuern zahlen müssen.
Das Ergebnis: Sinken in Irland die Steuersätze, gibt’s schön viel Druck auch für den Finanzminister von, sagen wir, Deutschland. Weshalb der dann eben auch Steuern senkt. Der schöne Nebeneffekt dabei ist: Damit dem Finanzminister der Haushalt trotz entsprechender Einnahmeausfälle nicht um die Ohren fliegt, wird er (noch) ordentlicher haushalten und Ausgaben kürzen, die nicht nötig sind. Am Ende müssen wir weniger Steuern zahlen, und der Staat verschwendet weniger Geld. Paradies. Da sind auch Steueroasen gesamtökonomisch eben eine tolle Erfindung. Weil sie den Wettbewerb verstärken, den Druck auf den Finanzminister erhöhen und so weiter.
Zu schön, um wahr zu sein
Klingt zu herrlich, um wahr zu sein? Ist es auch. Wobei der erste Teil der Verheißung noch ziemlich eindrucksvoll funktioniert hat. Fast überall sind seit Ende der Siebziger Jahre die Spitzensteuersätze drastisch gesenkt worden:
- in Großbritannien bis 2002 etwa von mehr als 80 auf 40 Prozent,
- in Deutschland von 56 auf weniger als 50 Prozent,
- in Japan von 75 auf 50 Prozent,
- in Südkorea gar von 89 auf 36 Prozent.
Ähnliches gilt für die Besteuerung von Unternehmen: Die Regelsätze fielen im Mittel in den Industrieländern von gut 50 Prozent 1982 auf weniger als 35 Prozent 20 Jahre später. Und die Zahl der Steueroasen stieg. Siehe oben.
Die Probleme beginnen bei der Verheißung, dass uns das angeblich allen guttut.
Zum Ersten konkurrieren weltweit ziemlich unterschiedliche Länder. Es gibt Staaten, die traditionell nicht so viel auf soziale Sicherung zählen oder so groß sind wie ein Stadtteil von Berlin – und die gar nicht so viele Steuern brauchen. Und es gibt Menschen, die ganz gern Steuern zahlen, wie unsere Freunde im Norden. Das sind schon mal ungleiche Voraussetzungen.
Hinzu kommt ein logisches Problem: Bei einem einzelnen (Ir-)Land mag das Kalkül aufgehen, mit Discountsteuersätzen so viel Geld von anderswo anzuziehen, dass in der Summe trotz niedriger Sätze ordentlich Steuereinnahmen reinkommen. Das funktioniert aber nur, wenn das nicht alle machen. Dann ist der Anreiz ja weg. Und es hätten zwar alle niedrige Steuersätze, aber dafür keiner mehr Geld in der Staatskasse. Auch blöd.
Womit wir beim zweiten Problem wären. Zweifelhaft ist, ob das große Steuersenken für Wohlhabende zu viel mehr toller Effizienz in den Staatsverwaltungen geführt hat. Es sei denn, man definiert monatelanges Warten auf neue Ausweispapiere als Zeichen für vorbildlich sparsamen Umgang mit staatlichen Mitteln.
Umverteilungspolitik. Von unten nach oben
Etliche Male wurden doktringetreue Steuerausfälle eher dadurch ausgeglichen, dass panisch Investitionsgelder gekürzt wurden (oft noch mitten in Rezessionen, was alles nur noch schlimmer machte). Oder dadurch, dass stattdessen andere Steuern angehoben wurden – auf Leute, die halt nicht mal schnell ins Ausland fliehen oder ein Konto auf den Kaimaninseln eröffnen können (da fährt ja kein ÖPNV hin).
Die Mehrwertsteuer stieg seit 1983 bei uns von 13 auf 19 Prozent. Gegen den Trend in der Betuchten-Besteuerung. Auch die durchschnittlichen Einkommensteuern sind längst nicht so stark gesenkt worden. Pech.
Im Ergebnis gibt es heute in den USA wie in Deutschland enorme Infrastrukturprobleme, und es müsste mehr Geld investiert werden – was aber, tja, in der Zwischenzeit Leute eingesteckt haben, die von sinkenden Spitzensteuer- oder Kapitalsteuern profitieren. Toller Wettbewerb.
Wie Thomas Piketty berechnet hat, dürften die gegenläufigen Trends bei den Steuersätzen stark auch zum Reichtumsgefälle in vielen Ländern beigetragen haben: Während die einen auf rasant steigende Kapitalgewinne kaum noch Steuern entrichten, muss der Rest seine ohnehin nur noch schwach wachsenden Einkommen mehr oder weniger unverändert versteuern.
All das könnte sogar erklären helfen, warum heute trotz etlicher Kürzungen in den Etats oft mehr Staatsschulden gemacht werden als früher. Oder die Steuern alles in allem gar nicht so viel weniger lasten. Beispiel Deutschland: Nachdem Anfang der Zweitausender Jahre der Spitzensteuersatz drastisch reduziert wurde und zudem die Konzerne deutlich weniger Steuern zahlten, gab es erst einmal hohe Staatsdefizite – bis am Ende zum Ausgleich die Mehrwertsteuer angehoben wurde. Umverteilungspolitik. Von unten nach oben.
Sowas ist auf Dauer weder ökonomisch sinnvoll – was unsere vermeintlich größten Leistungsträger an Steuervorteilen bekommen haben, hat zumindest nicht dazu geführt, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland heute höher ist als früher oder mehr Geld in die Zukunft investiert wird -, noch ist das gesellschaftlich durchzuhalten.
Ändern lässt sich all das dann aber auch nicht mit ein paar Moralappellen an Bono und die Queen und die anderen. Dafür braucht es ein Ende der irren Doktrin, nach der es angeblich gut ist, wenn Staaten um die niedrigsten Steuersätze konkurrieren. Dann braucht es sehr viel mehr internationale Register für Vermögen. Und harmonisierte Steuersätze. Und Strafen für Banken, die Geschäfte mit Steuerdiscountern machen.
Das geht. Alles eine Frage des Weltbilds.