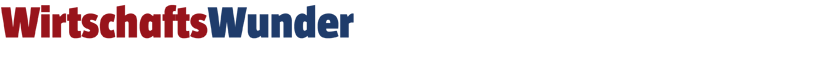Unser Wohlstand ist auf längere Sicht vielerlei Gefahren ausgesetzt: Donald Trump, Kim Jong Un, Islamismus, Klimawandel, Epidemien – und der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Zumindest bewerben sich deren Experten für Irgendwas-mit-Wirtschaft gerade unfreiwillig für die Aufnahme in die Todesliste.
Was Angela Merkels Truppe da an, nennen wir es Überlegungen, einbringt, um künftige Euro-Krisen zu vermeiden, hat das Zeug, den nächsten Crash eher zu beschleunigen als zu verhindern. Was vor allem daran liegen könnte, dass Ursachen und Verlauf der letzten Eurokrise noch nicht ganz durchdrungen wurden. Ein Feld, auf dem Monsieur Macron deutlich weiter scheint.
Es ist schon etwas befremdlich, wenn deutsche Politprofis erst über Monate wie kleine Jungs oder Mädchen weinen, Frankreichs Präsident wolle nur unser Geld – was als Annahme tumb ist, weil es sich aus keiner Aussage Macrons ergibt. Und die gleichen Politprofis dann den Mund kaum aufbekommen, wenn es darum geht, selber Vorschläge zur Euroreform zu machen – um sich nun, neueste Variante christdeutscher Ausreden, zu entrüsten, dass man so etwas ja nicht überstürzen dürfe. Leute, ist das Realsatire? Mehr als ein halbes Jahr nach Macrons Rede an der Sorbonne? Hoffentlich hört das keiner; die müssen uns ja für komplett blöd halten.
Der Wechsel aus Gegeiere und zunehmendem Abgesang verdeckt natürlich etwas anderes: Einen tiefen Zweifel, warum überhaupt etwas reformiert werden muss – wenn doch die Südländer selbst schuld waren, dass es zur Krise kam, wie es uns zumindest die gängige Krisendeutung weismachen will. Warum brauchen wir dann eine gemeinsame Einlagensicherung? Oder ein Euro-Budget? Oder einen Europäischen Währungsfonds (EWF)?
Wie falsches Management die Krise eskalieren ließ
Der Haken an dieser Selbst-Schuld-These ist, dass sich mit ihr kaum erklären lässt, warum die Krise derart eskalierte – und es am Ende selbst solidere Länder mitzog. Und solche, die wie Irland und Spanien anfangs gar keine hohen Staatsschulden hatten. Plausibler ist, dass es zwar hier und da unsolide Finanzen gab, dazu aber die Konjunktur vor der Krise auseinandergedriftet war – und das Ganze erst durch falsches Krisenmanagement derart eskalierte.
Was zum Euro-Drama geführt hat, sind vor allem drei Dinge:
- Vor der Krise lief die Konjunktur in Ländern wie Spanien und Irland prima – was dazu führte, dass dort viel Geld in den Bauboom ging, die Löhne stiegen und die Regierungen dank konjunkturbedingt toller Haushaltslage noch Steuern senkten, statt die Konjunktur zu bremsen; während in Deutschland Dauermisere herrschte, was wiederum zu fallenden Löhnen und immer neuen Sparrunden führte, die der Konjunktur nur noch mehr zusetzten.
- Als die Eurokrise Ende 2009 ihren Lauf nahm, fehlte eine Instanz, die der – in Finanzkrisen typischen – Eskalation der Angst etwas entgegensetzte; anders als in den USA oder Großbritannien, wo die Notenbanken sofort eingriffen. Das Ergebnis war die zunehmend irrationale Marktpanik, die 2012 auch Italien zu erfassen drohte und selbst in vermeintlichen Vorbildländern wie Österreich und den Niederlanden die Risikoprämien auf Staatsanleihen steigen ließ.
- Als die Finanzmärkte in Panik gerieten, versuchten Euro-Instanzen wie der deutsche Finanzminister, zappelige Anleger zu besänftigen, indem den Regierungen der Krisenländer monatlich neue Einschnitte und höhere Steuern auferlegt wurden – Stichwort Austerität. Was de facto dazu führte, dass sich die Wirtschaftslage noch verschlimmerte, weil die Leute immer weniger Geld hatten – und sich die Staatsfinanzen rezessionsbedingt wieder verschlechterten: Ein Teufelskreis, der nach gängiger Analyse viel Schaden angerichtet hat, etwa in Griechenland, wo die Wirtschaftsleistung weitgehend sinnlos um fast ein Viertel einbrach. Zerstörung statt Sanierung.
Es spricht viel dafür, dass sich nur so erklären lässt, warum das Drama just im Euroraum zur Systemkrise wurde und auf so viele Länder übersprang, wo die Sicherung erst nicht funktionierte; und warum es gut war, dass Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), 2012 die Systemgarantie aussprach; und warum, just seitdem der Austeritätseifer ab den Jahren 2013 und 2014 nachließ, auch das Wachstum in Ländern wie Spanien wieder anzog.
Wenn das stimmt, ist völlig irre, was Merkels Wirtschaftsverein als Mantra für die Euro-Zukunft seit Monaten ausgibt:
- Am Stabilitätspakt, der die Austerität festschreibt, soll „konsequent“ festgehalten werden.
- Die No-Bailout-Klausel, wonach Euro-Länder andere Euro-Staaten nicht finanziell helfen dürfen, sei „uneingeschränkt“ einzuhalten.
- Ein Europäischer Währungsfonds (EWS) könne nur unter Mitsprachen einzelner Sonderländer wie Deutschland agieren.
- Und erst mal dürfe es keine gemeinsame Einlagensicherung geben, bei der die Sparguthaben in den EU-Ländern gemeinsam vor dem Fall einer Bankpleite geschützt würden.
Die tumbe Defizitquoten-Buchhaltung des Stabilitätspakts hat nach gängigen Diagnosen zu Krise und Panik stark beigetragen – etwa dazu, dass in guten Zeiten zu wenig und in schlechten zu viel gespart wurde.
Dass es keine Finanzhilfen für Staaten geben darf, die an den Finanzmärkten unter Druck geraten, hat sich derweil als naive Annahme aus Schönwetterzeiten der Finanzglobalisierung erwiesen – als man dachte, dass Finanzmärkte kritische Situationen stets rational klären. Von wegen. Wer zehn Jahre nach dem fatalen Fallenlassen der Lehman-Bank deklariert, es dürfe per se keine Bailouts geben, hat offenbar gar nichts verstanden. Hilfe!
Und da hilft dann auch ein Jumbo-Rat aus Finanz- und Wirtschaftsministern wenig, den die Kanzlerin als Beitrag zur Euroreform nun ausgedacht hat. Krisenlösung durch Vermehrung.
Wenn die Diagnose stimmt, wirkt umgekehrt plausibler, was Macron so vorgeschlagen hat. Wenn es in solch kritischen Momenten wichtig ist, eine letzte Rettungsinstanz zu haben, wäre es gut, künftig neben der EZB noch weitere Stoppmechanismen zu haben, etwa über den EWF – zumal nicht sicher ist, ob die Notenbank früh genug reagiert und ein, sagen wir, deutscher Chef aus falschem Stabilitätseifer nicht zu lange zögern würde.
Warum Macron Recht hat
Deshalb wäre es auch für uns in Deutschland eine ziemlich tolle Idee, unser Geld über jene gemeinsame Einlagensicherung zu sichern, über die hierzulande so viel gezetert wird. Ist ja nicht so, dass bei uns Banken per se risikolos geführt werden, wie wir am Drama unserer größten deutschen Bank gerade beobachten können. Wenn alle Euroländer zusammen dafür geradestehen, dass im Notfall Ersparnisse ausbezahlt würden, wird es erst gar nicht zu Schlangen an den Bankschaltern kommen. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie nach der Ankündigung von Mario Draghi, notfalls alle Staatsanleihen aufzukaufen – und auch damals hat es geklappt. Von dem Moment an gab es ja keinen Grund mehr zur Panik.
Wenn die Diagnose der Krise stimmt, ergibt auch Sinn, über alles nachzudenken, was dazu beiträgt, die Konjunktur zwischen den Euroländern nicht allzu sehr auseinanderdriften zu lassen. Und dazu, dass Länder, die ohnehin schon kriseln, ihre Lage nicht durch heilloses Kürzen und Steuererhöhen noch verschlimmern. Wobei jenes gemeinsame Euro-Budget helfen könnte, das Länder in akuten Krisen unterstützen soll.
Oder eine europäische Arbeitslosenversicherung, wie sie nicht nur Macron vorschlägt – und bei der automatisch jene mehr einzahlen, bei denen die Konjunktur gerade überdurchschnittlich gut läuft. Zugunsten derer, bei denen es gerade schlecht läuft.
Es ist absurd, aus alledem immer nur abzuleiten, dass es darum geht, die Deutschen zahlen zu lassen. Als es 2001 bis 2005 bei uns kriselte, hätten wir nach solchen Modellen Geld bekommen. Das hätte geholfen zu verhindern, dass am Ende fünf Millionen Menschen arbeitslos waren. Es braucht eben schlauere Regeln als die tumbe Defizitreiterei. Auch eine Euro-Arbeitslosenversicherung lässt sich so gestalten, dass sich die Beiträge über längere Zeit ausgleichen – weil jedes Land mal bessere und mal schlechtere Zeiten erlebt. Im Zweifel braucht es auch einen Modus, um zu erkennen, wann Zeiten mehr oder weniger normal sind – und jeder für sich selbst verantwortlich sein kann; und wann der Ausnahmefall einer drohenden Panikwelle gilt, in dem es wenig bringt, den Regierungen ohnehin kriselnder Länder immer mehr Druck zu machen.
Über Details lässt sich streiten – und von mir aus kann man auch schön drauf achten, dass wir armen Deutschen nicht zu viel zahlen. Als fatal könnte sich in der nächsten Krise allerdings erweisen, jetzt nur herumzupampen – im Glauben an eine grotesk naive Südländer-sind-schuld-Krisendeutung. So eine falsche Diagnose kann böse enden. Das ist wie beim Arzt, der falsch diagnostiziert, und dann, sagen wir, die Hand vom Patienten amputiert, statt ihm einen Herzkatheter zu legen. Da ist der tot. Geht ja immerhin um unsere Währung.