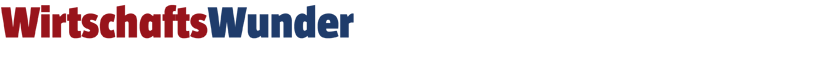Trotz aller Warnsignale verbreiten Ökonomen und Politiker seit Monaten stoisch die Hoffnung darauf, dass die Konjunktur bald wieder anzieht. Dabei ist die deutsche Wirtschaft längst bedrohlich dicht an einer tieferen Krise.
Startseite
> Chefökonom > Thomas Fricke: Wirtschaftskrise – Warum Deutschland einer Rezession gefährlich nah ist
Thomas Fricke: Wirtschaftskrise – Warum Deutschland einer Rezession gefährlich nah ist
27. April 2019
_______________________
Die Kolumne „Die Rechnung, bitte!“ erscheint seit dem 15. April 2016 im wöchentlichen Rhythmus auf Spiegel Online (SPON).