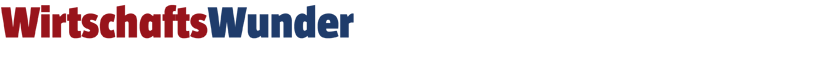Thomas Fricke: Konjunktur in Deutschland – Die Krise naht
Die Wirtschaft in Deutschland schwächelt „nur ein bisschen“? Das ist absurd, die typischen Warnsignale sind da. Jetzt gilt es, sich auf den nahenden Ernstfall vorzubereiten.
Peer Steinbrück gelangte zu zweifelhaftem Ruhm, als er inmitten der gerade eskalierenden Jahrhundertfinanzkrise noch im September 2008 verkündete, das alles sei Amerikas Problem. Und kein deutsches. Von Rezession könne bei uns keine Rede sein. Und selbst wenn, seien Konjunkturpakete sinnlos.
Schon wenige Wochen später verkündete der Bundesfinanzminister unbeirrt, dass Deutschland in der Rezession sei. Und es gut sei, dass die Regierung mit Konjunkturhilfen ordentlich dagegenhalte. Was dann auch wirkte, aber so spät kam, dass Deutschlands Wirtschaft 2009 erst einmal weit stärker schrumpfte als andere.
Nun sind zum Glück die Zeiten vorbei, in denen es vor lauter Marktfundamentalismus als verpönt galt, in konjunkturellen Notfällen regierungsamtlich gegen Rezessionen anzugehen. Diese Woche forderte selbst Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer – als solcher sonst ja eher der Kategorie Markt-vor-Staat zuzuordnen -, dass sich die Regierung auf den derzeit nahenden Ernstfall einstellen und eine subventionierte Kurzarbeiterregelung vorbereiten sollte, wie es sie 2009 neben anderen Maßnahmen gegeben hat.
Wirtschaft schwächelt nicht nur ein bisschen
Das Risiko scheint dennoch hoch, dass auch jetzt wieder der Ernst der Lage für das Land unterschätzt wird. Und die Regierenden darauf viel zu spät reagieren – bevor die Arbeitslosigkeit hochschnellt. Für ein Gegensteuern gebe es „derzeit keine Notwendigkeit“, verlautete diese Woche aus der Bundesagentur für Arbeit. Ähnliches ließ der Arbeitsminister melden. Dabei könnte sich das ebenso bald als Unsinn erweisen wie einst bei Peer Steinbrück. Nur dass diesmal drastischere Konsequenzen drohen.
Mit jedem Monat wirken jene Diagnosen zunehmend absurd, wonach die Konjunktur in Deutschland nur mal ein bisschen schwächelt.
- Die Industrie produzierte dieses Frühjahr bereits fast fünf Prozent weniger als zum Höhepunkt vor einem Jahr.
- Die Verkäufe des einstigen Exportweltmeisters in den Rest der Welt stagnieren.
- Was zuerst die Industrie zu spüren bekam, lässt mittlerweile auch Dienstleister schwächeln – nach Ifo-Umfragen hat sich die Geschäftslage dort stark verschlechtert; der entsprechende Index lag zuletzt 2016 so niedrig wie jetzt.
- Selbst am Arbeitsmarkt gibt es zunehmend ernste Warnsignale: Erstmals seit Jahren blieb jenseits der üblichen saisonalen Schwankungen die Zahl der Menschen, die keinen Job finden, drei Monate hintereinander unverändert. Der historisch eindrucksvolle Abbau der (offiziellen) Arbeitslosigkeit scheint vorüber.
Bedenklich an den jüngsten Signalen ist, dass immer mehr auf einen Abschwung hindeutet, der sich möglicherweise bereits verselbständigt hat:
- Für die kommenden Monate erwarten erstmals seit der Rezession 2009 mehr Firmen sinkende Exportumsätze als steigende – ein regelrechter Absturz im Sog der Trump’schen Handelskriegsspiele, des drohenden No-Deal-Brexits und der Rezession im wichtigen Absatzland Italien.
- Wie gefährlich der Trend ist, lässt auch die Tatsache erahnen, dass in der deutschen Industrie zuletzt gut zwölf Prozent weniger Aufträge für Vorleistungen wie etwa Stahl eingingen – ein typisches konjunkturelles Alarmsignal dafür, dass auch die Nachfrage auf den folgenden Stufen der Produktionskette nachlässt.
- Was die Unternehmen wiederum vorsichtiger werden lässt, größere Projekte zu starten: Auf entsprechend nachlassende Investitionen deutet der Einbruch der Aufträge für Investitionsgüter aus dem Inland hin. Sie lagen im Frühjahr um fast sieben Prozent niedriger als noch im letzten Quartal 2018.
Kein Wunder. Was die Wirtschaft zögern und zweifeln lässt, dürfte nichts weniger sein als der Mix aus strukturellen Brüchen etwa in der konventionellen Autoproduktion und einer Krise der Globalisierung, wie sie sich im Wirtschaftsnationalismus der Donald Trumps, Boris Johnsons oder Matteo Salvinis ausdrückt. Und die schlicht jene am meisten trifft, die in den schönen alten Zeiten am meisten auf Globalisierung und den netten Wettbewerb gesetzt hatten – so wie Deutschland. Was auch erklärt, warum Deutschland derzeit konjunkturell schlechter dasteht als etwa Frankreich oder selbst die Griechen (auf weit niedrigerem Niveau, klar).
Auch hier gilt, dass die Dinge eher schlimmer zu werden drohen. Es spricht ja nicht viel dafür, dass Donald Trump übermorgen aufhört zu poltern. Oder Matteo Salvini. In Großbritannien haben gerade stramme Rechtspopulisten die Regierung übernommen. Was jenes Risiko eines harten Brexits weiter hat steigen lassen, das Britanniens Konjunkturwerte ebenso abrupt abstürzen ließ wie in den vergangenen Tagen das britische Pfund (und deutsche Exporte auf der Insel noch teurer und schwer verkäuflich machen wird). Für die USA ergaben Umfragen unter Einkaufsmanagern gerade, dass die Industrie ihre Lage und Aussichten mittlerweile so skeptisch beurteilt wie zuletzt – am Ende der großen Rezession 2009.
Gibt es trotzdem noch Chancen, dass in Deutschland das Schlimmste ausbleibt – jenes Hochschnellen der Arbeitslosigkeit, das seit dem Märchen von der Wunderwirkung von Schröders Agenda 2010 hierzulande als schier undenkbar gilt?
Möglich. Nur schwinden die mit jedem Tag gerade rapide. Der Verweis auf die bisher noch ausbleibende Großkrise könnte schon bald eher an den schlechten alten Witz von dem Mann erinnern, der aus dem zehnten Stock des Hochhauses springt – und auf Höhe des fünften deklariert, es sei bislang alles gut gegangen.
Nach den Ifo-Umfragen liegt der Anteil der Firmen, die in den nächsten Monaten entlassen wollen, um mittlerweile fast 15 Prozentpunkte höher als der jener, die noch einstellen – ein atemberaubender Absturz, der sich mit Meldungen darüber deckt, dass nach den großen Autokonzernen jetzt auch wichtige Zulieferer wie Schaeffler ![]() oder Mahle massiv Stellen abbauen. Auch hier gilt, dass der Trend gefährlich auf den Rest der Wirtschaft übergreift: Bei den Dienstleistern plant eine stetig schrumpfende Mehrheit, noch Leute einzustellen.
oder Mahle massiv Stellen abbauen. Auch hier gilt, dass der Trend gefährlich auf den Rest der Wirtschaft übergreift: Bei den Dienstleistern plant eine stetig schrumpfende Mehrheit, noch Leute einzustellen.
So viel Kurzarbeit wie lange nicht
Hochgeschnellt ist umgekehrt der Anteil der Industriefirmen, die mangels Nachfrage für die nächsten Monate mit zunehmender Kurzarbeit im eigenen Betrieb rechnen. Das meldet fast jedes zehnte Unternehmen jetzt – so viele wie zuletzt, als die Euro-Krise 2012/13 zu eskalieren und dies die Exportwirtschaft mitzuziehen drohte. Bei Herstellern von Fahrzeugen liegt der Anteil der Kurzarbeitsbetriebe in einigen Zweigen schon bei 30 Prozent, in der Textilindustrie bei 25 Prozent.
Darauf zu warten, ob sich dieser Trend zum Desaster ausweitet, dürfte sich bald als fahrlässig erweisen – schon, weil die ersten Entlassungswellen über Einkommensverluste und Schockwirkung zu neuen Nachfrageeinbrüchen für die gesamte Wirtschaft führen können und damit zu neuen Abstürzen und Entlassungen.
Die Krise von 2009 scheint gezeigt zu haben, dass erleichterte Regeln für Kurzarbeit helfen können. Ob das diesmal auch so gut wirkt – und reicht – ist damit nicht gesagt. So schlimm die Umstände damals waren, ging es vor allem darum, eine Art wirtschaftlichen Herzinfarkt zu beheben, den der Beinahekollaps des Finanzsystems im Herbst 2008 mit sich gezogen hatte. Weil für ein paar Wochen damals das Urvertrauen fehlte, von Geschäftspartnern Geld zu bekommen. Die Möglichkeit, Beschäftigte erstmal auf Kurzarbeit zu setzen, hat den Firmen da geholfen, die kritischen Monate ohne größere Entlassungen zu überbrücken. Das trug neben Abwrackprämien und Notenbankgeldsegen dazu bei, die Abwärtsspirale zu stoppen.
Diesmal geht es womöglich darum, eine viel tiefer sitzende Krise aufzufangen – jene Wirren einer Welle aus Populismus, Globalisierungszweifeln und strukturellen Brüchen, die gerade die deutsche (Auto-) Industrie treffen. Da wird es zur Abwendung einer tieferen Rezession mehr brauchen als günstigere Kurzarbeitsregeln für ein paar Monate.
_______________________
Die Kolumne „Die Rechnung, bitte!“ erscheint seit dem 15. April 2016 im wöchentlichen Rhythmus auf Spiegel Online (SPON).