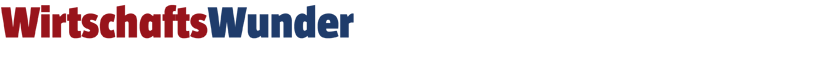Für ein paar Monate sah es aus, als bliebe uns nach Brexit und Trump erspart, was in den Dreißigerjahren für die Welt allmählich zum Desaster wurde – jener Mix aus Populismus, autoritären Politausflügen, Handels- und richtigen Kriegen. Wo doch in Frankreich Emmanuel Macron gegen die Rechtsextreme Marine Le Pen gewonnen hat, in den Niederlanden die Rechtspopulisten den Regierungsantritt verpassten, und in Deutschland, naja, trotz Einzug der AfD in den Bundestag irgendwie doch alles bei Merkel blieb. Und Donald Trump? Der entzückte deutsche Konzernchefs mit Steuergeschenken. Vielleicht doch ein Lieber, dieser US-Präsident? Gruß an Herrn Jo Kaeser von Siemens.
Vorbei. Spätestens seit vergangenem Wochenende ist das Gespenst wieder da. Seit der US-Präsident Strafzölle ankündigte und ein größerer Handelskrieg droht – erstmals seit eben diesen Dreißigern. Und seit in Europas drittgrößtem Land Italien die strammrechten Populisten fast ein Viertel der Stimmen bekommen haben – und die Irgendwielinks-Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung noch einmal 33 Prozent.
Erst eine Bankenkrise, dann Rezession und hohe Arbeitslosigkeit, gefolgt von heillosen Versuchen, die Staatsfinanzen via Steuererhöhung und Kürzungen zu sanieren. Dazu ein Aufstieg populär-autoritärer Parteien mit zunehmendem Hang zum nationalen Alleingang. All das hat es vor gut acht Jahrzehnten gegeben. All das gibt es, mehr oder weniger, auch jetzt wieder. Wenn auch noch in gemäßigter Form. Noch.
Umso bemerkenswerter ist es, mit welchem Gleichmut in Deutschland gerade mit der Frage hantiert wird, wer für all das verantwortlich ist. Da ist der Italiener halt selber schuld, typisch. Aber sind wir für das eine oder andere nicht auch mitverantwortlich? Nicht zur Selbstkasteiung. Sondern um daraus zu lernen – und die Katastrophe noch zu verhindern.
Die Italiener haben mehr reformiert als wir Deutsche
Es hat etwas Abwegiges, die politische Entwicklung in Italien auf nationalen Klamauk zu reduzieren. Rechte Populisten regieren auch in Österreich. In Frankreich fehlte nicht viel. Und in Deutschland sind sie je nach Umfrage mittlerweile so stark wie die SPD. Zumal es zu den dümmeren Klischees zählt, dass der Italiener per se nichts hinkriegt – also mit uns deutschen Flughafen- und Automobil- und Diesel-Bauern nicht mithalten kann.
Italiens Regierungen haben unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Mario Monti eine Rentenreform durchbekommen, für die wir wahrscheinlich drei Jahrhunderte Konsenssuche gebraucht hätten. Es gab eine Arbeitsmarktreform, die selbst überheblichere deutsche Oberlehrer lobten. Das Land hat seit einiger Zeit einen Exportüberschuss und erfüllt seit vier Jahren das Höchstens-Drei-Prozent-Kriterium fürs Staatsdefizit. Der italienische Staat nimmt – wenn man Zinszahlungen abzieht – seit Jahren deutlich mehr Geld ein, als er ausgibt. Das ist viel eindrucksvoller, als das, was Wolfgang Schäuble bei uns jahrelang vorgegaukelt hat.
Wenn das Land politisch ins Desaster zu rutschen und den Rest Europas mitzuziehen droht, dann nicht aus mangelnder Schäublisierung. Sondern vielleicht sogar, im Gegenteil, weil sich italienische Politiker zu viel von all der Austerität, dem Kürzen und Steuererhöhen haben aufdrängen lassen – durch ökonomisch eher bildungsferne (deutsche) Lehrmeister. Mit womöglich historisch noch stark unterschätzten Folgen. Nicht nur in Italien.
Die Nazis profitierten vom Kürzungskurs
Ein abwegiger Gedanke? Welch epochale Folgen ein falsch verstandener Sanierungskurs haben kann, lässt die Studie* einer Gruppe internationaler Forscher um den renommierten Wirtschaftshistoriker Christopher Meissner erahnen, die gerade veröffentlicht wurde. Die Ökonomen gingen dabei akribisch der Frage nach, was genau zu Beginn der fatalen Dreißigerjahre dazu führte, dass in Deutschland die Nazis so viel neuen Zulauf bekamen. Dazu werteten sie detailliert die Wahlergebnisse nach Regionen in der Zeit zwischen 1930 und 1933 aus, also der Zeit des stärksten Zustroms für die NSDAP – und verglichen die Ergebnisse damit, wie stark in denselben Regionen in dieser Zeit auf Druck des Austeritäts-Kanzlers Heinrich Brüning die Steuern erhöht oder die Sozial- und andere Ausgaben gekürzt wurden, um damit die Staatsfinanzen zu sanieren; was je nach Region in Deutschland damals unterschiedliche Ausmaße annahm.
Das beeindruckende Ergebnis: Den größten Zulauf bekamen die Nazis gar nicht dort, wo es als Folge von Finanzcrash und Rezession per se etwa besonders viele Arbeitslose gab. Die wählten damals vor allem die Kommunisten. Die Stimmenzuwächse gab es vor allem dort, wo besonders brachial Austerität durchgezogen wurde, die Steuern besonders deutlich angehoben und Ausgaben etwa für Rente oder Gesundheit gekürzt worden waren. Das betraf oft Leute aus der Mittelschicht – kommt uns bekannt vor, oder?
In Regionen, wo Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen stärker ausfielen als im Schnitt, stieg der Stimmenanteil, den die Nazis bis 1933 bekamen, um zwei bis fünf Prozentpunkte mehr als anderswo, so die Berechnungen der Ökonomen.
Klar, es gab eine Menge anderer Einflüsse, die den Aufstieg der Nationalsozialisten beförderten. Das Spektakuläre an den Auswertungen der Ökonomen ist trotzdem: Der zusätzliche Schub, den der Unmut über die Austerität für die Nazis in der entscheidenden Zeit bis 1933 offenbar brachte, war den Berechnungen zufolge gerade so groß, dass es am Ende für die NSDAP zur Mehrheit reichte. Anders gesagt: Ohne diesen Effekt und die heillosen Brüningschen Sparversuche hätten die Nazis womöglich gar nicht an die Macht kommen können.
Jetzt ließe sich zu Recht einwenden, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland damals schlimmer war als in den vergangenen Jahren in Italien – mit fast einem Drittel Arbeitslosigkeit; und dass auch der Austeritätseifer unter Brüning größer war. Nur ändert das an der fatalen Grundlogik womöglich nichts.
Die ökonomischen Tücken allzu eifriger Sanierungspolitik bleiben bestehen: Weil zu viel Steueranheben und Kürzen wirtschaftlich perverse Effekte mit sich bringt – wenn weniger Geld da ist, kann die Wirtschaft auch weniger umsetzen, was zu weniger Jobs und weniger Steuereinnahmen führt. Der Finanzminister hat damit am Ende nur sehr wenig gewonnen, das Land aber viel verloren. Dieses Phänomen erklärt auch, warum Italiens Alt-Staatsschulden trotz Sanierungsmaßnahmen noch immer nicht stärker sinken. Und warum die Wirtschaft nach wie vor nur mäßig wächst.
Auch an einem zweiten, gesellschaftlich psychologischen Problem staatlicher Sparpolitik ändern die Unterschiede zwischen damals und heute wenig: Es ist auf Dauer schwer zu vermitteln, dass etliche Menschen im Land höhere Steuern zahlen oder mit weniger Geld auskommen müssen – wenn dieselben Leute für die Probleme, wenn überhaupt, nur sehr indirekt verantwortlich sind.
Das gilt zum Beispiel für typische Bankenkrisen: Da werden am Ende Staatsausgaben für Leute gekürzt, die von Derivaten noch nie was gehört haben. Was wiederum nicht besser wird, wenn die Kürzungen dann auch noch von, sagen wir, einem deutschen Finanzminister nahegelegt werden, der sich für die Folgen seiner Empfehlungen nicht verantworten muss, weil er in dem Land nicht zur Wahl steht. Nicht nur ein Problem für Italiener.
Bizarre Streits zwischen den Verlierern
All das könnte erklären, warum auch bei uns die Wut mancher Menschen im Land so groß zu sein scheint, wenn – nach all den Kürzungen der Schröder-Ära – plötzlich doch Geld für Bankenrettung oder, deutlich weniger, für Flüchtlinge da zu sein scheint. Und warum es am Ende zu bizarren Streits kommt, wo Verlierer vergangener Kürzungsorgien an Essener Tafeln mit Flüchtlingen ums Essen streiten. Was ja nicht wirklich die Schuld der Beteiligten ist, sondern derjenigen, die einst öffentliche Hilfen für Bedürftige unter Verweis auf die nötige Sanierung der Staatsfinanzen gekürzt haben.
Es spricht einiges dafür, dass am italienischen Drama, das sich seit dem Wochenende abzeichnet, auch der Eifer deutscher Macher schuld ist, dem Land etwas aufzudrängen, was ökonomisch zweifelhaft wirkt und zu Recht den Unmut derer stärkt, die für eine Krise zahlen müssen, für die sie wenig können – ohne dass sie das Gefühl haben, für den eigenen Verzicht belohnt zu werden.
Dann hat es etwas hochgradig Groteskes und Lernresistentes, wenn Angela Merkels vermeintlich wirtschaftskennende Parteileute kürzlich lautstark polterten, dass es keine Gnade mehr mit Ländern geben dürfe, die nicht strikt auf Kürzungskurs bleiben. Deutsche Überheblichkeit zum Fremdschämen.
Umso besser, dass der neue Finanzminister Olaf Scholz schon einmal ein bisschen Einsicht hat durchblicken lassen: dass es falsch war, anderen Ländern in Europa schlechte Empfehlungen zu geben – Ratschläge für Dinge, die in der deutschen Geschichte zu ganz großen Katastrophen beigetragen haben.
Höchste Zeit, einen deutschen Beitrag dazu zu leisten, die Schäden zu beheben. Um Schlimmeres zu verhindern.
* „Austerity and the rise of the Nazi party“, Gregori Galofré-Vilà, Christopher M. Meissner, Martin McKee, David Stuckler, NBER Working Paper 24106, Dezember 2017.